| |
|
 |
|
| |
| |
Eine auf den defekten Grundlagen aufgebaute ökonomische Theorie |
| |
Wie ein Philosoph auf den Pfad der Ökonomie bzw. des Kapitals geriet |
| |
|
|
|
| |
|
Bevor Marx sich mit der Ökonomie wissenschaftlich beschäftigte, hatte er, von Hegel ausgehend, philosophische Prinzipien erarbeitet, die seine ökonomischen Analysen orientierten. Vor dem wissenschaftlichen Erforscher des Kapitalismus gab es den Philosophen, der den Ausbruch einer großen sozialen Revolution als unvermeidlich ankündigte. Diese Überzeugung leitete Marx, als er die kapitalistische Wirtschaft zu studieren begann. Das heißt, die theoretischen Grundsätze waren festgeschrieben, bevor die eigentliche Forschungsarbeit begann. |
|
| |
|
Heinz Abosch, Das Ende der großen Visionen |
|
|
|
|
|
Hayek wurde dank seiner Fähigkeit, auf der Oberfläche der Sache mit rhetorischen Floskeln zu schwadronieren, zu den berühmtesten Neoliberalen des vorigen Jahrhunderts. Er hat sich große Mühe gegeben, den Marxismus als „Konstruktivismus“ zu entlarven und zu denunzieren. Der Begriff Konstruktivismus wird in verschiedenen Fachbereichen und Disziplinen verwendet und an ihm selbst lässt sich nichts aussetzen. In einem abwertenden Sinne versteht man aber unter Konstruktivismus die Neigung von naiven und gutwilligen Menschen, Ideen und Inhalte beliebig zu kombinieren, sich sozusagen eine Wirklichkeit aus purer Fantasie zu erfinden. Genau diesen Konstruktivismus will Hayek dem Marxismus unterstellen. Tatsächlich kritisiert er den Marxismus als Utopie, aber so will er es nicht nennen. Das Wort Utopie klingt nämlich abgenutzt und billig; spricht man von Konstruktivismus, hört sich dies irgendwie „wissenschaftlich“ und „seriös“ an. Außerdem ist es Marx auch deshalb nicht leicht vorzuwerfen, er würde Utopien entwerfen, weil er selber Utopien scharf kritisierte - in seiner Kritik der so genannten utopischen Sozialisten. Damit aber nicht genug. Die ökonomische Analyse des Kapitalismus im „Kapital“, dem Hauptwerk von Marx, das drei umfangreiche Bände umfasst, endet mit keinem Entwurf eines Modells der neuen kommunistischen Wirtschaft und Gesellschaft. Wo ist dann nun die Marxsche Utopie? Marx als Schöpfer des Wissenschaftlichen Sozialismus gibt es einfach nicht. Er ist immer nur ein zorniger Prophet der Apokalypse und einer frohen Botschaft gewesen. Damit ist er seiner dialektischen Methode treu geblieben: sie erlaubt es nicht, in die Zukunft zu schauen.
Der „junge Marx“ - wie man zu sagen pflegt - war in der deutschen Philosophie zu Hause; der „spätere Marx“, hat sich fast ausschließlich mit der ökonomischen Theorie beschäftigt, also mit der Politischen Ökonomie, wie man damals sagte. Der „junge Marx“ als Philosoph hat herausgefunden, dass der Kapitalismus nicht überleben kann; Marx als Ökonom meinte, die Lösung dieses Rätsels gefunden zu haben. Es ist folgerichtig von Marx, dass er diese Lösung gerade in der ökonomischen Theorie suchte, weil er als Philosoph - Hegel auf den Kopf stellend - die Entscheidung getroffen hat, dass die treibende Kraft der Geschichte die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. der Produktivität sei. Schon in seinem Manifest (1848) stellt der dreißigjährige Marx fest, dass Produktivitätssteigerung sinkende Preise bedeutet, so dass diese
„ ... die schwere Artillerie sind, mit der die Bourgeoisie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, sich die Produktionsweise der Bourgeoisie anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Worte, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde.“

Wie erreicht man aber eine höhere Produktivität? Nur mit mehr Kapital, also durch die Akkumulation des Kapitals, lautet die Marxsche Antwort. Nicht also von ungefähr heißt sein Hauptwerk „Das Kapital“. Es war aber nicht seine Idee, Kapital bzw. Kapitalmenge mit Produktivität gleich zu setzen. Diese führt über Adam Smith zu Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) zurück. Der Grundpfeiler der marxschen Theorie ist also ein alter Hut. Wie passt aber diese, schon damals alte Theorie zu den historischen Tatsachen?
Es genügt, nur einen kurzen Blick auf die vorkapitalistischen Wirtschaften zu werfen, um festzustellen, dass bei ihnen die Akkumulation des Kapitals keine Rolle spielte. Erst recht lässt sich bei der feudalen Wirtschaft keine Tendenz zur Akkumulation des Kapitals erkennen. Sie war ganz bestimmt nicht besser damit ausgestattet als die Sklavenwirtschaft. Aber so tief in die Geschichte wollen wir jetzt nicht gehen. Innerhalb der reinen ökonomischen Theorie braucht man sich in der Tat nicht dafür zu interessieren, ob das „Gesetz“ über die Akkumulation des Kapitals irgendwann früher seine Gültigkeit besaß, etwa in der Sklavengesellschaft oder im Feudalismus. Man kann für diese rückständigen Gesellschaften einfach sagen, sie waren noch nicht so weit und sie dann als solche außer Acht lassen (wegabstrahieren).
Dass die vorkapitalistischen Wirtschaften unfähig waren, die Produktivität zu steigern, passt zwar nur schlecht zum Marxschen Historischen Materialismus, aber zweifellos sehr gut zu seiner Theorie des Kapitals bzw. der Produktivitätssteigerung. Man kann nämlich sagen: Weil es in den vorkapitalistischen Wirtschaften keine Akkumulation des Kapitals gab, konnten sie auch die Produktivität nicht steigern. Dazu war erst die kapitalistische Marktwirtschaft fähig. Sollte sich der Zusammenhang, dass nämlich das Produktivitätswachstum durch die Kapitalausstattung bedingt ist, als richtig erweisen, hätte dies weit reichende Folgen für die Zukunft. Man hätte damit eine wichtige Regel für die postkapitalistische bzw. kommunistische Wirtschaft in der Hand: Man bräuchte nur ausreichend zu akkumulieren und die Produktivität würde immer weiter steigen. Wäre die kommunistische Wirtschaft sogar im Stande, mehr zu akkumulieren als die kapitalistische, dann würde sie diese ökonomisch überholen können. So einfach hat sich Marx die geschichtliche Entwicklung vorgestellt - den „Gang der Produktivkräfte durch die Geschichte“. Wir wollen uns im Folgenden dieses „Gesetz“ über die Akkumulation des Kapitals näher anschauen. Marx hat ihm - wie bereits angedeutet - die letzten Jahrzehnte seines Lebens gewidmet, und in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ niedergeschrieben.
- Im ersten Schritt- im nächsten Beitrag - werden wir untersuchen, ob es wirklich stimmt, dass die Kapitalmenge die Produktivität (und damit auch das Sozialprodukt) bestimmt.
- Im zweiten Schritt- im darauf folgenden Beitrag - werden wir klären, ob der Kapitalismus wirklich zusammenbrechen muss, wie es Marx behauptet.
Bevor wir uns mit dieser Problematik befassen, müssen wir vor allem zwei ökonomische Begriffe klären: Kapital und Profit (Profitrate). Uns wird es hier aber nicht um eine präzise Definition dieser Begriffe gehen. Eine solche gibt es vielleicht gar nicht, weil man sich in der ökonomischen Theorie noch nicht ganz im Klaren ist, was Kapital und Profit (Profitrate) wirklich bedeuten. Wenn man aber nicht ins Detail gehen will, lassen sich diese Begriffe ziemlich leicht erklären und auch verstehen. Eigentlich dürfte dann mit ihnen auch ein Laie keine Probleme haben.
Fangen wir mit der einfachen Feststellung an, dass der eigentliche Zweck der Wirtschaft darin zu sehen ist, Konsumgüter zu produzieren. Die Wirtschaft produziert aber, wie wir wissen, nicht nur Konsumgüter. Dies hat damit zu tun, dass der Mensch nicht mit bloßer Hand produziert (wirtschaftet), sondern mit Maschinen (Anlagen). Weil aber jede Maschine (Anlage) im Laufe der Zeit verschleißt (amortisiert), muss folglich jede Wirtschaft neben den Konsumgütern auch Maschinen produzieren, sowie die von ihnen verbrauchten Rohstoffe und Halbprodukte. Wir bezeichnen all diese Güter als Produktionsgüter. Wenn man Konsumgüter und Produktionsgüter zusammen nimmt, spricht man vom Sozialprodukt.
Wir nehmen in unserem numerischen Beispiel an, der Wert der Konsum- und Produktionsgüter der Wirtschaft am Ende einer Reproduktionsperiode betrage 10.000. Ob es sich um Millionen oder Milliarden handelt, ob man als Rechnungseinheit Dollar, Yen, Euro, ... nimmt, ist für die folgende Untersuchung unwichtig. Es sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass alle zahlenmäßigen Werte in unserem numerischen Beispiel ganz normale Preise, also Geldpreise sind. (In der Theorie bezeichnet man sie auch als nominale Preise; die relativen oder die realen sind etwas anderes.) Weil also die Währung bzw. die Preiseinheit unwichtig ist, werden wir im Weiteren nur reine Zahlen nehmen.
Um quantitative Verhältnisse zu verdeutlichen, ist es üblich, Diagramme zu verwenden. Wir tun dies auch. All unsere Diagramme werden nach einem bestimmten Muster aufgebaut sein: als sich zwei gegenüber stehende Balken. Der linke Balken stellt die Wirtschaft am Anfang, der rechte Balken am Ende der betrachteten (Re-)Produktionsperiode dar. Der linke Balken stellt somit die gesamtwirtschaftlichen (Produktions-)Kosten, der rechte Balken das am Ende der betrachteten (Re-)Produktionsperiode erwirtschaftete (Brutto-)Sozialprodukt dar.
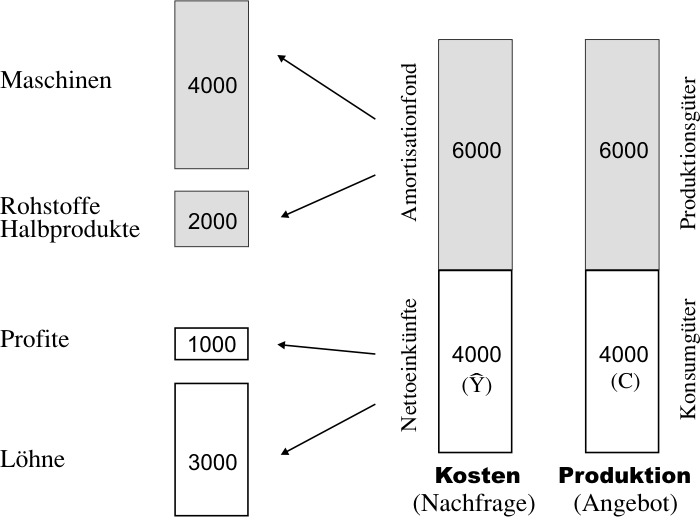
Über den rechten Balken brauchen wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir schauen uns jetzt die Kostenseite bzw. Produktionsseite genauer an. Der untere Teil des linken Balkens stellt die Leistungen aller verschiedenen Menschen dar, die direkt oder indirekt mit der Wirtschaft zu tun haben. Für ihre Leistungen beziehen sie Einkünfte, mit denen in unserem Fall die Konsumgüter nachgefragt werden. Weil alle diese Einkünfte problemlos vollständig konsumiert werden können, bezeichnen wir sie als Nettoeinkünfte der Wirtschaft. Wir haben sie noch zusätzlich auf die Profite der Kapitalisten (1000) und die Löhne der Arbeiter (3000) aufgeteilt. So hat auch Marx es getan.
Marx war der Auffassung, die Kapitalisten leisteten keinen wirklichen Beitrag zum Sozialprodukt, so dass die Profite nichts anderes bedeuten würden als einen institutionellen Lohnraub - eine Exploitation der Arbeiterklasse. Die Verteilung zwischen Profiten und Löhnen lässt sich numerisch auf zweierlei Weise ausdrücken. Marx hat die Profite (1000) den Löhnen (3000) gegenüber gestellt, was konkret 0.33 ausmacht. Wenn man diese Zahl mit 100 multipliziert, bekommt man 33%. Diesen Wert bezeichnet Marx als Mehrwertrate, aber dem Sinn nach ist es noch besser sie als Ausbeutungsrate zu bezeichnen. In der „bürgerlichen“ Ökonomie wird der gleiche Zusammenhang durch eine andere mathematische Formel ausgedrückt. In dieser Formel stehen die Profite bzw. die Löhne im Verhältnis zu dem ganzen Nettoeinkommen (4000), woraus sich die folgenden zwei Größen ergeben:
Profitquote = 1000/4000 * 100 = 25% bzw. Lohnquote = 3000/4000 * 100 = 75%
Ist die Profitquote ein besserer Indikator für die soziale Verteilung des Einkommens als die Mehrwertrate? Nein, sie sind gleich gut, auch wenn sie sich „ein bisschen“ unterscheiden. Es gilt nämlich dasselbe für die Profitquote wie für die Mehrwertrate: wenn eine steigt, steigt auch die andere und umgekehrt. Dies wird auch für andere Begriffe gelten, die für uns wichtig sein werden, die sich auf das Kapital beziehen.
Was ist das Kapital? Ökonomen verspüren schon seit langem große Lust, alles zum Kapital zu erklären, was sich irgendwie ökonomisch rentabel - also Geld bringend - anwenden lässt. Ist auch ein Mensch Kapital? Wer Zeitungen ließt, wird dies stark annehmen müssen, weil er bestimmt auf den Begriff Humankapital gestoßen ist. Marx spricht nicht von Humankapital, sondern von variablem Kapital, wenn er die Arbeiter meint, die für Lohn bei dem Kapitalisten ihre Arbeit (Arbeitkraft) verkaufen. In unserem Beispiel hat das variable Kapital den Wert 4000.
Warum nennt Marx dieses Kapital variabel? Dies hat mit seiner Ausbeutungstheorie zu tun. Das in die Löhne investierte Kapital kostet den Kapitalisten 3000, aber dieses Kapital vergrößert sich während der Produktion, also es variiert, so dass sein Wert am Ende auf 4000 steigt. Die Differenz von 1000 (den Mehrwert) steckt der Kapitalist in die eigene Tasche.
Im üblichen Sinne versteht man unter Kapital das, was in Produktionsmittel investiert wird. Marx nennt dieses Kapital konstant, weil es seinen Wert während der Produktion nicht ändert. Es überträgt nur seinen Wert auf die Produktion und zwar auf alle hergestellten Güter, sowohl auf die Produktionsgüter als auch auf die Konsumgüter. Dies bringt unsere Darstellung der Wirtschaft durch zwei Balkendiagramme leider nicht zum Ausdruck. Auf den ersten Blick kann in der Tat der Eindruck entstehen, die Produktionsmittel würden mit Hilfe von Produktionsmitteln, die Konsumgüter jedoch mit Hilfe von Dienstleistungen, hergestellt werden. Dem ist natürlich nicht so. Dieser falsche Eindruck kann sich vielleicht auch dadurch verstärken, dass die innere Struktur der Balkendiagramme gleich ist. Dies kommt daher, dass in unserem Fall absichtlich davon ausgegangen wird, dass die Wirtschaft nur soviel Produktionsgüter herstellt, wie viel sie während der betrachteten Reproduktionsperiode verbraucht hat. Die Wirtschaft hat sich somit nur auf einem gleichen Niveau reproduziert. Man bezeichnet solch eine Wirtschaft, die weder wächst noch schrumpft, als stationär.
Schauen wir uns jetzt die Produktionsgüter bzw. das konstante Kapital genauer an. Es hat konkret den Wert 6000 und wird auf dem Diagramm auch zweigeteilt. Nehmen wir an, dass in dem Gesamtwert der verbrauchten Produktionsgüter der Verschleiß der Maschinen 4000 ausmacht und der Rest von 2000 auf die Rohstoffe und Halbprodukte entfällt. Aber diese zwei Komponenten machen noch nicht das ganze konstante Kapital einer Wirtschaft aus. Auch das müssen wir kurz erörtern, aber dann haben wir das Kapital vollständig erfasst.
Nehmen wir an, die betrachtete Reproduktionsperiode dauert ein Jahr. Es kann sein, dass eine Maschine genau nach einem Jahr verbraucht (verschlissen) ist. Dann würde man sich am Anfang des nächsten Jahres eine neue Maschine besorgen müssen. Es kommt aber in der Praxis nicht oft vor, dass eine Maschine nur 1 Jahr verwendbar ist. Nehmen wir deshalb an, in unserem Fall halten die Maschinen im Durchschnitt 5 Jahre. Der gesamte Wert der Maschinen wäre dann 5*4000 = 20000. Wenn man dazu noch den Wert der Halbprodukte und Rohstoffe hinzufügt, beträgt der Wert des konstanten Kapitals der ganzen Wirtschaft 22000. Man spricht in dieser Hinsicht auch vom Kapitalstock. Das Verhältnis zwischen dem gesamten konstanten und dem variablen Kapital ist die fundamentale Größe der Marxschen ökonomischen Theorie. Er nennt sie „organische Zusammensetzung des Kapitals“. In unserem konkreten Fall beträgt sie
22000/4000 = 5.5
Auch in der „bürgerlichen“ ökonomischen Theorie hat man eine numerische Größe, die verdeutlicht, wie eine Wirtschaft mit Kapital ausgestattet ist, den Kapitalkoeffizient. Im nächsten Bild sind diese zwei Begriffe bzw. Größen genauer erklärt.
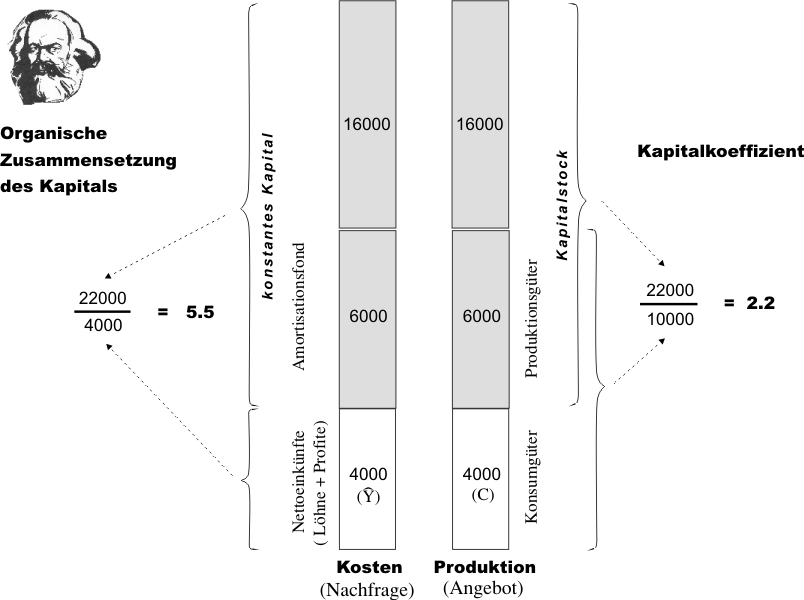
Der Kapitalkoeffizient ist nicht numerisch identisch mit der Marxschen organischen Zusammensetzung des Kapitals, aber er drückt den gleichen Zusammenhang aus. (So etwa, wie wir es schon bei der Mehrwertrate und der Profitrate hatten.) Wenn nämlich die organische Zusammensetzung des Kapitals wächst, wächst auch der Kapitalkoeffizient und umgekehrt. Deshalb können wir für die Prüfung der Marxschen Theorie auch die Statistik über den Kapitalkoeffizienten nehmen.
Anmerkung: In der „bürgerlichen“ Ökonomie gibt es auch eine andere Größe, die sich auf die Kapitalausstattung der Wirtschaft bezieht, genannt Kapitalintensität. Vereinfacht gesagt, gibt sie an, wie viel Kapital (Anlagenvermögen) eine Wirtschaft im Durchschnitt für einen Erwerbstätigen benötigt. Auf den ersten Blick würde man sagen, die Kapitalintensität entspreche genau der Marxschen organischen Zusammensetzung des Kapitals. Dies stimmt aber nicht. Es ist schnell erklärt warum.
Wie vergleichen wir zwei Wirtschaften, oder eine Wirtschaft in zwei verschiedenen Perioden? Sollten wir die gleichen Preise für die gleichen Güter nehmen? Das müssen wir bestimmt tun. Dies wäre auch kein Problem. Wenn aber die zu vergleichenden Wirtschaften nicht gleich produktiv sind, steckt in den gleichen Produktionsgütern nicht die gleiche Menge von Arbeit. Dann nützen uns die gleichen Geldpreise gar nichts. Und dies ist ein gewaltiges Problem. Es gibt nämlich bis heute keine Methode, mit der wir die Menge der Arbeit in den Kapitalgütern auch nur annähernd gut ermitteln könnten. Beim Kapitalkoeffizienten dagegen brauchen wir dies alles gar nicht zu berücksichtigen. Dort haben sowohl die Güter des Zählers, als auch die des Nenners, die gleiche Inflationsrate und Produktivität, so dass sich diese Wirkungen (Veränderungen) im Endergebnis aufheben.
|
|
|
| |
|
|
|
|