| |
| | | blättern ( 1 / 39 ) |  |
| |
Das Denkmuster, nach dem der Frühliberale die Welt begreift |
| |
Die paradigmatischen Grundlagen der frühliberalen Theorie |
| |
|
|
|
Alle wichtigen Lehren oder Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft - heute sagt man einfach Theorien - sind Produkte der europäischen Moderne, genauer gesagt ihrer rationalistischen Philosophie. Nach dieser Philosophie sollte sich die ganze Realität mit einer bestimmten Zahl von universal und zeitlos geltenden Prinzipien bzw. logischen Mustern erklären lassen. Dieser rationalistischen Auffassung folgend, muss eine jede Wissenschaft ein System, d. h. ein nach bestimmten Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein (Kant). Eine solche Auffassung von Wissenschaft scheint uns heute so selbstverständlich, als ob dies schon immer so gewesen sein müsste. Das trifft natürlich nicht zu, im Gegenteil. Diese Auffassung ist eine sehr junge Errungenschaft des menschlichen Geistes und zugleich eine radikale Wende in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. In der vormodernen Zeit hat man mit Lehren oder Doktrinen etwas andres gemeint, nämlich ein loses Bündel aus Erfahrungen, Überlieferungen, Wahrnehmungen, Mythen, Empfindungen, Intuitionen, … zusätzlich auch noch mit Wünschen, Erwartungen und Werten durchwoben, welche von einer Autorität ausgewählt, zusammengefügt und zu ewigen Dogmen erklärt wurden. Folglich galten neue Erkenntnisse oder Praktiken als wahr und richtig, wenn sie im Einklang mit diesen Dogmen standen, worüber ebenfalls die Autoritäten zu entscheiden hatten.
Die rationalistische Denkweise der modernen Wissenschaften hat sich sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht als dermaßen erfolgreich erwiesen, wie man es früher nicht einmal träumen konnte. Mit ihr ließen sich umfangreiche und detaillierte Kenntnisse über die Natur gewinnen, die sich in der Praxis sehr einbringlich anwenden ließen. Dank ihnen konnte die Produktivität dermaßen schnell und kräftig steigern, wie es in der Geschichte noch nie zuvor der Fall war. Der frühmoderne Rationalismus schien deshalb auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.
Gerade in den erfolgreichsten (Natur-)Wissenschaften hat sich herausgestellt, dass sich neue Bereiche der Realität bzw. neue empirische Tatsachen nur mit neuen Denkweisen erschließen lassen, die aber mit den gewohnten Denkweisen kein widerspruchsfreies Ganzes bilden können. Seitdem wissen wir, dass man logisch nicht auf nur eine einzige Weise denken kann. Dies war das endgültige Ende der maximalistischen Ansprüche des neuen Rationalismus und seiner Vorstellung von einem geschlossenen Erkenntnissystem, das für die ganze Welt gültig wäre. Das rationalistische Wissen zerfiel in partielle und autonome Denksysteme, die untereinander nicht mehr kommensurabel („kompatibel“) sind. Heute bezeichnet man sie als wissenschaftliche Paradigmen. Setzt sich ein neues Paradigma in einer Wissenschaft durch, spricht man von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Revolution oder vom Paradigmenwechsel (Thomas Kuhn).
In den Sozialwissenschaften will man trotzdem immer noch nichts von „wissenschaftlichen Revolutionen“ bzw. „Paradigmenwechseln“ wissen. Vor allem in der Wirtschaftswissenschaft nicht, die übrigens wie kaum eine andere in den letzten zwei Jahrhunderten theoretisch steril und praktisch erfolglos blieb. Deshalb habe ich es für notwenig gehalten, am Anfang dieses thematischen Bereichs mit dem Schwerpunkt Das Elend der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung: ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung:
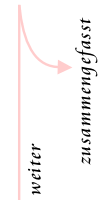 |

Wie bereits angedeutet, haben die Philosophen am Anfang der Moderne von der Ratio zu viel erwartet. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist die reale Welt zu komplex für die logischen Erklärungssysteme, die sich der homo sapiens ausdenken kann. Wir können uns zwar vorstellen, dass im Kopf des Allmächtigen das ganze Universum, bis ins letzte Detail, ein einziges, in sich schlüssiges logisches System sein kann, aber der Kopf des Menschen ist für ein solches System offensichtlich zu klein. Dies hätte eigentlich schon deutlich sein müssen, als sich feststellen ließ, dass die neu entstandenen Wissenschaften ihre eigenen Theorien und Methoden - jede Wissenschaft für sich allein - entwickelten, um den von ihnen abgegrenzten kleinen Bereich der Wirklichkeit zu erforschen. Wenn eine universelle Wissenschaft möglich wäre, müssten sich die speziellen Wissenschaften um solche eigenen Theorien und Methoden nicht kümmern.
Das alles wollte man aber vorerst übersehen und die nahe liegenden Schlüsse nicht ziehen. Es ist aber verständlich. Als die modernen Wissenschaften gerade entstanden sind, war es nicht abwegig eine Zeitlang abzuwarten und hoffen, dass zumindest innerhalb dieser speziellen Wissenschaften immer gleiche Denkweisen gelten würden, so dass die Wissenschaftler ihre Fortschritte immer weiter, sozusagen linear und kumulativ, machen würden. Es kam aber anders. Allmählich wurde es immer deutlicher, dass sich auf den gleichen analytischen Grundlagen doch nicht immer weitere Fortschritte machen lassen. Die Theorien sind sozusagen nicht dermaßen belastbar, dass man auf sie immer weiter und höher aufbauen kann. Wie oben ebenfalls angedeutet, hat man diese schmerzhafte Erfahrung gerade in der erfolgreichsten Naturwissenschaft, in der Physik, zuerst gemacht: Man erinnert sich an die Relativitätstheorie von Einstein, die schon einiges in der Welt der klassischen Physik durcheinander gebracht hat. Die Quantenphysiker danach haben dann so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Danach wurde es unmöglich, sich vor der befürchteten Konsequenz zu drücken, dass es nicht einmal in den speziellen Wissenschaften möglich ist, rationale Grundlagen zu schaffen, die für alle Zeiten gültig wären. Das Alte muss von Zeit zu Zeit geopfert werden, weil es mit dem Neuen nicht kommensurabel ist. Der geschlossene Rationalismus vom Anfang der Moderne, ich bezeichne ihn auch als Monologizismus, war also eine Anmaßung. Er war es auch noch in einer anderen Hinsicht.
Unterstreichen wir noch einmal, dass es die praktischen, also im strengsten Sinne empirischen Erfolge waren, die bei den rationalistischen Philosophen der Moderne maximalistische Hoffnungen weckten, sie würden die ganze Realität in ein einzigeslogisch widerspruchsfreies System packen können. Gerade diese empirischen Erfolge haben die unvorsichtigen Rationalisten am Anfang der Moderne zu dem gewagten Gedanken verführt, dass das „richtige“ Denken mit der Realität identisch, oder zumindest sozusagen ein genauer Spiegel des Seienden wäre. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es nicht einmal im Rahmen einer einzelnen Wissenschaft eine für alle Zeiten richtige Denkweise gibt, kann man sich nun sicher sein, dass das rationale Denken die Realität, wie sie „wirklich ist“, also das sogenannte „Ding an sich“ (Kant) nie erreichen kann. Seitdem lässt sich nicht mehr daran zweifeln, dass sich die rationalen Schlussfolgerungen nur auf die Oberfläche der Realität beziehen können, also auf das, was unseren - nicht besonders empfindlichen und präzisen - Sinnen zugänglich ist. Das nennt man Tatsachen. Für einen Philosophen kann dies enttäuschend wenig sein, aber für die Existenz des Menschen reicht ein solches Wissen - über die Tatsachen - doch völlig aus. Die Wissenschaften können also auch nach dem Zerfall des alten geschlossenen Rationalismus weitermachen wie bisher, nur müssen sie sich der Notwendigkeit bewusst sein, dass ihren neuen Durchbrüchen, also der Eroberung von neuen „Schichten“ der Tatsachen, immer eine Änderung der Denkweise vorausgehen muss, also ein neues Paradigma. Da stellt sich die Frage, wann eine Wissenschaft für ein neues Paradigma reif ist und wie der Paradigmenwechsel vor sich geht.
Zu einem Paradigma gehört vor allem eine bestimmte Zahl von Annahmen, Prinzipien und Methoden, welche die Wissenschaftler zur Grundlage - zur axiomatischen Basis - ihrer Forschung machen. Erst diese Grundlagen machen eine systematische Forschung - und die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern - möglich. Als ein logischer Rahmen bestimmen sie, was empirisch beobachtet und erforscht werden soll, welche Ergebnisse als relevant gelten können und wie diese interpretiert werden dürfen. Die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft sind immer sehr abstrakt. Als solche sind sie sozusagen ziemlich leer oder nackt - und haben schließlich kaum einen Bezug zu den empirischen Tatsachen, was einen sehr wichtigen theoretischen Vorteil hat. Als solche lassen die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft viele freie analytische Räume für Generierung und Implementierung neuer Begriffe und logischer Muster. Solange die Forschung diese freien Räume mit Inhalten füllt, was in der ursprüngliche Phase der Entwicklung eines neuen Paradigmas der Fall ist, spricht man von „normaler Wissenschaft“ (Thomas Kuhn).
Es gibt aber nur bestimmte Typen von Begriffen und Zusammenhängen, die sich ohne Verletzung der logischen Konsistenz im Rahmen eines Paradigmas analytisch generieren und implementieren lassen, mit anderen Typen geht das jedoch nicht. Dies macht die „normale Wissenschaft“ hilflos, wenn sie in ihrer Forschung auf neue Tatsachen oder neue Zusammenhänge zwischen den Tatsachen stößt. Für sie bietet das gültige Paradigma keinen freien Raum. Diesen Stand hat die Forschung erreicht, wenn die Wissenschaftler von Anomalien oder Paradoxen sprechen. Was lässt sich dann tun? Um die „normale Wissenschaft“ bzw. das alte Paradigma zu retten, greift man zuerst nach Ad-hoc-Hypothesen. Man erhofft sich, mit ihnen würde man den logischen Rahmen, innerhalb dessen das Paradigma noch seine Gültigkeit behält, breiter machen können. Das kann aber nicht gelingen. Die Ad-hoc-Hypothesen bedeuten keinen wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Durch sie wird eine Wissenschaft beliebig.
Diese Beliebigkeit einer durch Ad-hoc-Hypothesen überfrachteten Wissenschaft ist sogar von einem Laien leicht zu erkennen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zerrissen. Sie bietet eine große Zahl von theoretisch „richtigen“ Vorschlägen, um ein konkretes Problem zu lösen, die im Nachhinein alle scheitern, und eine große Zahl von „richtigen“ Prognosen über die Zukunft, die sich alle als falsch erweisen. Die sich häufenden Paradoxe und das folgende Wetteifern der Fachleute um bessere Ad-hoc-Hypothesen ist ein sicheres Zeichen, dass eine Wissenschaft degeneriert (Imre Lakatos). Dann bleibt einer seriösen Wissenschaft nichts anderes übrig, als sich von der alten paradigmatischen Grundlage zu verabschieden und sich nach einer völlig neuen umzuschauen. Hat man sie gefunden, kann der nächste Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Paradigma wird aus der Wissenschaft entweder gänzlich verstoßen (Thomas Kuhn) oder von dem neuen eingewickelt (Gaston Bachelard). |
 |
| |
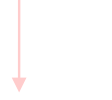 |
Verschiedene Schulen in einer Wissenschaft, nur weil sie schon eine beträchtliche Zahl von Anhängern haben, müssen noch nicht verschiedene Paradigmen bedeuten. Es ist in der Tat schwer von einem Paradigmenwechsel in den letzten zwei Jahrhunderten in der Wirtschaftswissenschaft zu sprechen. Wenn man sich ihre wichtigsten Schulen näher anschaut, stellt man nämlich fest: Entweder fehlt ihnen ein richtiger Bezug zur Realität (Marxismus, Neoliberalismus) oder sie besitzen keine ausreichend komplexen und konsistenten analytischen Grundlagen (Ordoliberalismus, Keynesianismus). Deswegen wurde den Ökonomen immer wieder vorgeworfen, sie wären denkträge und ideenarm. Ganz falsch kann dieser Vorwurf nicht sein. Wenn man nämlich zu dem, was schon Adam Smith (1723-1790) gesagt hat noch die nachfragetheoretischen Gedanken von J.-C.-L. Sismondi (1773-1842) und Thomas Malthus (1776-1834) mitzählt, besteht der Rest der ökonomischen Theorie bis heute hauptsächlich aus dem Fortschritt in den Techniken und Methoden, mit denen die bereits vorhandenen Ideen weitergeführt und argumentiert werden. Man kann sich nicht leicht des Eindrucks erwehren, dass nicht nur den Wirtschaftswissenschaftlern, sondern auch den anderen Sozialwissenschaftlern nach dem 18. Jahrhunderts die Kreativität abhanden gekommen ist. „Wir haben eine auf das Äußerste hochentwickelte und moderne Naturwissenschaft und materielle Kultur, mannigfaltiger und weit wirksamer als je zuvor. Trotzdem sind die Einrichtungen und das soziale Denken, durch welches wir diese materielle Kultur zu kontrollieren und auszubeuten suchen, ein antiquiertes Mosaik, ein Sammelsurium aus Relikten von der Steinzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“, stellt nach dem Zweiten Weltkrieg der amerikanische Soziologiehistoriker Harry E. Barnes fest. Seitdem haben sich die Naturwissenschaften und Technologien in einem sich weiter beschleunigenden Tempo weiterentwickelt, die Regierungs- und Wirtschaftsformen, Rechtspraktiken und Erziehungssysteme sind dagegen dieselben geblieben. Der Soziologe Robert Merton hat diesen lahmen Gang der Sozialwissenschaften und ihren immer größeren Abstand zu den Naturwissenschaften mit einer gelungenen Wendung auf den Punkt gebracht: Die Sozialwissenschaften seien „noch nicht reif für ihren Einstein, weil sie noch nicht einmal ihren Kepler gefunden haben“. Dem zum Trotz, oder womöglich gerade deshalb, wird von den Sozialwissenschaftlern in immer kürzeren Abständen etwas angeboten, was auf dem Campus und in den Medien als völlig neu und originell angepriesen wird, sich aber sehr schnell als eine hastige Umgruppierung altbekannter Bausteine, als Verschiebung des Ausgangspunktes oder aber als Spaltung eines geläufigen Begriffs erweist. Dadurch degeneriert die wissenschaftliche Forschung immer mehr zur Vergewaltigung der Sprache.
Seitdem haben sich die Naturwissenschaften und Technologien in einem sich weiter beschleunigenden Tempo weiterentwickelt, die Regierungs- und Wirtschaftsformen, Rechtspraktiken und Erziehungssysteme sind dagegen dieselben geblieben. Der Soziologe Robert Merton hat diesen lahmen Gang der Sozialwissenschaften und ihren immer größeren Abstand zu den Naturwissenschaften mit einer gelungenen Wendung auf den Punkt gebracht: Die Sozialwissenschaften seien „noch nicht reif für ihren Einstein, weil sie noch nicht einmal ihren Kepler gefunden haben“. Dem zum Trotz, oder womöglich gerade deshalb, wird von den Sozialwissenschaftlern in immer kürzeren Abständen etwas angeboten, was auf dem Campus und in den Medien als völlig neu und originell angepriesen wird, sich aber sehr schnell als eine hastige Umgruppierung altbekannter Bausteine, als Verschiebung des Ausgangspunktes oder aber als Spaltung eines geläufigen Begriffs erweist. Dadurch degeneriert die wissenschaftliche Forschung immer mehr zur Vergewaltigung der Sprache.
Wie schwach und langsam der Fortschritt der Sozialwissenschaften im Vergleich zu den Naturwissenschaften ist, lässt sich mit einem gedanklichen Experiment verdeutlichen. Stellen wir uns vor, wir hätten die berühmtesten Vorgänger der heutigen Sozialwissenschaften, zum Beispiel die antiken Philosophen, wieder zum Leben erweckt und sie zu einer Diskussion der Sozialwissenschaftler eingeladen. Auch wenn wir diese Gäste aus der längst vergangenen Zeit vorher nicht in die Thematik eingeweiht hätten, würden sie im Laufe der Diskussion schnell die Variationen ihrer damaligen Thesen erkennen. Die Aufklärer und Rationalisten vom Anfang der Moderne würden sich sogar unauffällig am Diskurs beteiligen können. Bei den Naturwissenschaftlern würde dagegen ein Treffen mit den Vorgängern des Faches völlig anders aussehen, sogar dann, wenn wir nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückgehen würden. Laden wir im Sinne unseres gedanklichen Experiments zu einer Diskussion der heutigen Physiker zum Beispiel ihre Kollegen ein, die erst vor einem Jahrhundert zu den prominentesten gehörten. Diese würden in den Vorträgen ihrer Nachfolger kaum einen der ihnen vertrauten Ansätze und Prinzipien erkennen, und mit etlichen Grundbegriffen wüssten sie überhaupt nichts anzufangen. Weil sie schnell feststellen müssten, dass in der Diskussion sogar manche ihnen vertrauten und geläufigen logischen Gesetze buchstäblich auf den Kopf gestellt worden sind, würden sie vermuten, sie seien irrtümlicherweise in eine esoterische Séance geraten.
Uns wird es aber in den folgenden Beiträgen nicht um die Wirtschaftswissenschaft in den letzten zwei Jahrhunderten gehen, sondern um die Wissenschaft davor, die am Ende des Mittelalters und am Anfang der Moderne entstanden ist. Wir werden sie als Frühliberalismus bezeichnen. In den folgenden Beiträgen werden wir nach der Antwort suchen, ob diese Lehre oder Doktrin eine authentische und originelle Denkweise war und ob sie einen berechtigten Anspruch darauf erheben kann, als Paradigma zu gelten.
Ist die frühliberale Lehre ein richtiges wissenschaftliches Paradigma?
Erinnern wir uns zuerst an die Tatsache, dass sich in den westlichen Staaten seit Anfang der Moderne die ökonomische und politische Ordnung entwickelt, die zweifellos deutlich anders ist als alles, was man in der ganzen Geschichte zuvor gekannt hat. Es sind in einer historisch sehr kurzen Zeit ökonomische und politische Institutionen und Strukturen entstanden, die es früher nie gab. Man kann dies auf zweierlei Weise erklären: Es lässt sich annehmen, dass all diese so sichtbaren und weit reichenden Änderungen nichts mit den Absichten, Bestrebungen und Überlegungen der Menschen zu tun hätten, so dass sie ihre Existenz ausschließlich einer nicht nachvollziehbare Vorsehung oder Notwendigkeit der historischen Entwicklung zu verdanken hätten. Die Geschichte würde also durch eine mysteriöse innere Kraft einem endgültigen Zweck folgen, die Menschheit wäre dann nur Mittel zu diesem Zweck. Das haben einige Philosophen auch behauptet, Marx ist der bekannteste von ihnen. Keine dieser finalistischen Auffassungen ist aber glaubwürdig. Dann bleibt nichts anderes übrig, als die Änderungen in dieser Zeit mit den Fortschreiten in den Geisteswissenschaften am Ende des Mittelalters zu erklären: Mit den neuen Ansätzen in der Ethik, Wirtschaftswissenschaft und anderen Sozialwissenschaften.
Inwieweit waren diese Fortschritte neu? In den Beiträgen, die folgen werden, werden wir zeigen, dass sich zumindest bei den wichtigsten und einflussreichen Denkern der vormodernen Zeit folgende drei Merkmale als wesentlich und bezeichnend identifizieren lassen:
1. Die spekulative (metaphysische) „Erforschung“ der Realität:
Es gab schon immer unter den Philosophen Materialisten, bei denen die Materie alleine im Mittelpunkt (des Seins) stand, aber ihren Begriff der Materie darf man jedoch keinesfalls mit dem Begriff der Natur, so wie er von den Naturwissenschaften verstanden wird, verwechseln. Für diese Philosophen war die Materie stets eine abstrakte und jenseitige (ontologische) Kategorie, eine Konkurrenz zu Gott - nicht weniger aber auch nicht mehr. Ihre Gedanken an eine konkrete und schmutzige Materie zu verschwenden, war dagegen für sie unerheblich oder gar unter ihrer Würde. Folglich blieb vor dem Anfang der Moderne auch die Erforschung des Menschen und der Gesellschaft eine rein spekulative.
2. Die positive menschliche Natur:
Die menschlichen Wesen galten in allen vormodernen Philosophien und Theologien an sich als gut, so sollten sie zumindest ursprünglich geschaffen worden sein. Und wenn sie tatsächlich nicht gut gewesen sind, dann sollte es sich angeblich um Abweichungen oder Entfremdungen von ihrer wahren Natur handeln.
3. Die hierarchische gesellschaftliche Ordnung:
Wenn nicht alle im Einklang mit ihrer wahren - positiven - Natur leben, obwohl sie es im Prinzip könnten, wäre es sowohl für diese Individuen selbst als auch für die ganze Gesellschaft nur vom Vorteil, dass man sie zu ihrem „wahren“ Wesen zwingt. Deshalb sind die vormodernen Denker auf die eine oder andere Weise zu hierarchischen, von den Aristokraten oder Eliten gelenkten Ordnungen gelangt.
Was haben die Denker der Moderne, die Frühliberalen, an diesen grundlegenden Auffassungen geändert?
1. Die spekulative Forschung wurde durch die Erforschung von Tatsachen ersetzt.
2. Anstelle der positiven menschlichen Natur hat man sich für die negative entschieden.
3. Anstatt hierarchischer Ordnung ist ihre Konsequenz eine dezentrale Ordnung.
Bei solch extremen Unterschieden ist es durchaus berechtigt von einer radikalen Wende im abendländischen Kulturraum sprechen: von einem richtigen Paradigmenwechsel. Ein wissenschaftliches Paradigma muss aber auch ein in sich schlüssiges und ausreichend komplexes System von Gedanken sein. Auch das ist den Frühliberalen gelungen, wie wir es in den folgenden Beiträgen begründen und nachweisen werden.
Die dezentrale Ordnung ist in der Tat die wichtigste und sehr weit reichende Konsequenz der paradigmatischen Wende, worüber man kaum streiten würde. Durch unermüdliche Arbeit der Ideologen des Kapitalismus wurde die Meinung verbreitet und durchgesetzt, diese neue Ordnung wäre eine Vision der Wirtschaft und Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Freiheit begründet sei. Das ist sie aber nicht, sondern etwas völlig anderes.
Die frühliberale Lehre als eine Konzeption der geregelten Ordnung
Was die Frühliberalen meinten und sagen wollten, darüber gingen die Meinungen bald stark auseinander. Seltsamerweise hat auch Marx den Anspruch erhoben, die „englischen klassischen politischen Ökonomen“ richtig verstanden zu haben und behauptet, seine eigene Theorie wäre die richtige Fortentwicklung ihrer Auffassungen. Die auf den Grundlagen des Walrasschen partikel-mechanischen Modells des allgemeinen Gleichgewichts entwickelte Markttheorie, die sogenannte Neoklassik - oder wie man es heute üblicherweise sagt: der Neoliberalismus - wird auch als die einzig richtige Interpretation und Vollendung der klassischen Theorie deklariert. Angeblich habe man im Grunde diese Theorie nur auf strenge mathematische Grundlagen gestellt. Wir werden sehen, dass nichts falscher als das sein kann. Auch die Nachfragetheorie, sowohl die klassische (Sismondi, Malthus) als auch die Keynessche Theorie sind grundsätzlich mit der Markttheorie, wie sie noch Adam Smith konzipierte, einverstanden. Das gilt auch für weitere, weniger verbreitete ökonomische Lehren und Ansätze. Dies legt uns nahe, dass die frühliberale Auffassung über die dezentrale Ordnung sehr unvollendet und entwicklungsfähig war. Unsere Untersuchung wird zeigen, dass sie sich auf noch eine Weise vervollständigen und weiterentwickeln kann. Wir können dies heute dank einer neuen Wissenschaft, der Kybernetik, besser verstehen als früher.
|
|
|