| |
|
 |
|
| |
| |
Das Denkmuster, nach dem der Neoliberale die Welt begreift |
| |
Die paradigmatischen Grundlagen der neoliberalen Theorie |
| |
|
|
|
Alle wichtigen Lehren oder Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft - heute sagt man einfach Theorien - sind Produkte der europäischen Moderne, genauer gesagt ihrer rationalistischen Philosophie. Nach dieser Philosophie sollte sich die ganze Realität mit einer bestimmten Zahl von universal und zeitlos geltenden Prinzipien bzw. logischen Mustern erklären lassen. Dieser rationalistischen Auffassung folgend, muss eine jede Wissenschaft ein System, d. h. ein nach bestimmten Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein (Kant). Eine solche Auffassung von Wissenschaft scheint uns heute so selbstverständlich, als ob dies schon immer so gewesen sein müsste. Das trifft natürlich nicht zu, im Gegenteil. Diese Auffassung ist eine sehr junge Errungenschaft des menschlichen Geistes und zugleich eine radikale Wende in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. In der vormodernen Zeit hat man mit Lehren oder Doktrinen etwas andres gemeint, nämlich ein loses Bündel aus Erfahrungen, Überlieferungen, Wahrnehmungen, Mythen, Empfindungen, Intuitionen, … zusätzlich auch noch mit Wünschen, Erwartungen und Werten durchwoben, welche von einer Autorität ausgewählt, zusammengefügt und zu ewigen Dogmen erklärt wurden. Folglich galten neue Erkenntnisse oder Praktiken als wahr und richtig, wenn sie im Einklang mit diesen Dogmen standen, worüber ebenfalls die Autoritäten zu entscheiden hatten.
Die rationalistische Denkweise der modernen Wissenschaften hat sich sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht als dermaßen erfolgreich erwiesen, wie man es früher nicht einmal träumen konnte. Mit ihr ließen sich umfangreiche und detaillierte Kenntnisse über die Natur gewinnen, die sich in der Praxis sehr einbringlich anwenden ließen. Dank ihnen konnte die Produktivität dermaßen schnell und kräftig steigern, wie es in der Geschichte noch nie zuvor der Fall war. Der frühmoderne Rationalismus schien deshalb auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.
Gerade in den erfolgreichsten (Natur-)Wissenschaften hat sich herausgestellt, dass sich neue Bereiche der Realität bzw. neue empirische Tatsachen nur mit neuen Denkweisen erschließen lassen, die aber mit den gewohnten Denkweisen kein widerspruchsfreies Ganzes bilden können. Seitdem wissen wir, dass man logisch nicht auf nur eine einzige Weise denken kann. Dies war das endgültige Ende der maximalistischen Ansprüche des neuen Rationalismus und seiner Vorstellung von einem geschlossenen Erkenntnissystem, das für die ganze Welt gültig wäre. Das rationalistische Wissen zerfiel in partielle und autonome Denksysteme, die untereinander nicht mehr kommensurabel („kompatibel“) sind. Heute bezeichnet man sie als wissenschaftliche Paradigmen. Setzt sich ein neues Paradigma in einer Wissenschaft durch, spricht man von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Revolution oder vom Paradigmenwechsel (Thomas Kuhn).
In den Sozialwissenschaften will man trotzdem immer noch nichts von „wissenschaftlichen Revolutionen“ bzw. „Paradigmenwechseln“ wissen. Vor allem in der Wirtschaftswissenschaft nicht, die übrigens wie kaum eine andere in den letzten zwei Jahrhunderten theoretisch steril und praktisch erfolglos blieb. Deshalb habe ich es für notwenig gehalten, am Anfang dieses thematischen Bereichs mit dem Schwerpunkt Das Elend der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung: ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung:
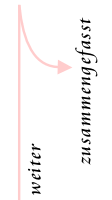 |

Wie bereits angedeutet, haben die Philosophen am Anfang der Moderne von der Ratio zu viel erwartet. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist die reale Welt zu komplex für die logischen Erklärungssysteme, die sich der homo sapiens ausdenken kann. Wir können uns zwar vorstellen, dass im Kopf des Allmächtigen das ganze Universum, bis ins letzte Detail, ein einziges, in sich schlüssiges logisches System sein kann, aber der Kopf des Menschen ist für ein solches System offensichtlich zu klein. Dies hätte eigentlich schon deutlich sein müssen, als sich feststellen ließ, dass die neu entstandenen Wissenschaften ihre eigenen Theorien und Methoden - jede Wissenschaft für sich allein - entwickelten, um den von ihnen abgegrenzten kleinen Bereich der Wirklichkeit zu erforschen. Wenn eine universelle Wissenschaft möglich wäre, müssten sich die speziellen Wissenschaften um solche eigenen Theorien und Methoden nicht kümmern.
Das alles wollte man aber vorerst übersehen und die nahe liegenden Schlüsse nicht ziehen. Es ist aber verständlich. Als die modernen Wissenschaften gerade entstanden sind, war es nicht abwegig eine Zeitlang abzuwarten und hoffen, dass zumindest innerhalb dieser speziellen Wissenschaften immer gleiche Denkweisen gelten würden, so dass die Wissenschaftler ihre Fortschritte immer weiter, sozusagen linear und kumulativ, machen würden. Es kam aber anders. Allmählich wurde es immer deutlicher, dass sich auf den gleichen analytischen Grundlagen doch nicht immer weitere Fortschritte machen lassen. Die Theorien sind sozusagen nicht dermaßen belastbar, dass man auf sie immer weiter und höher aufbauen kann. Wie oben ebenfalls angedeutet, hat man diese schmerzhafte Erfahrung gerade in der erfolgreichsten Naturwissenschaft, in der Physik, zuerst gemacht: Man erinnert sich an die Relativitätstheorie von Einstein, die schon einiges in der Welt der klassischen Physik durcheinander gebracht hat. Die Quantenphysiker danach haben dann so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Danach wurde es unmöglich, sich vor der befürchteten Konsequenz zu drücken, dass es nicht einmal in den speziellen Wissenschaften möglich ist, rationale Grundlagen zu schaffen, die für alle Zeiten gültig wären. Das Alte muss von Zeit zu Zeit geopfert werden, weil es mit dem Neuen nicht kommensurabel ist. Der geschlossene Rationalismus vom Anfang der Moderne, ich bezeichne ihn auch als Monologizismus, war also eine Anmaßung. Er war es auch noch in einer anderen Hinsicht.
Unterstreichen wir noch einmal, dass es die praktischen, also im strengsten Sinne empirischen Erfolge waren, die bei den rationalistischen Philosophen der Moderne maximalistische Hoffnungen weckten, sie würden die ganze Realität in ein einzigeslogisch widerspruchsfreies System packen können. Gerade diese empirischen Erfolge haben die unvorsichtigen Rationalisten am Anfang der Moderne zu dem gewagten Gedanken verführt, dass das „richtige“ Denken mit der Realität identisch, oder zumindest sozusagen ein genauer Spiegel des Seienden wäre. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es nicht einmal im Rahmen einer einzelnen Wissenschaft eine für alle Zeiten richtige Denkweise gibt, kann man sich nun sicher sein, dass das rationale Denken die Realität, wie sie „wirklich ist“, also das sogenannte „Ding an sich“ (Kant) nie erreichen kann. Seitdem lässt sich nicht mehr daran zweifeln, dass sich die rationalen Schlussfolgerungen nur auf die Oberfläche der Realität beziehen können, also auf das, was unseren - nicht besonders empfindlichen und präzisen - Sinnen zugänglich ist. Das nennt man Tatsachen. Für einen Philosophen kann dies enttäuschend wenig sein, aber für die Existenz des Menschen reicht ein solches Wissen - über die Tatsachen - doch völlig aus. Die Wissenschaften können also auch nach dem Zerfall des alten geschlossenen Rationalismus weitermachen wie bisher, nur müssen sie sich der Notwendigkeit bewusst sein, dass ihren neuen Durchbrüchen, also der Eroberung von neuen „Schichten“ der Tatsachen, immer eine Änderung der Denkweise vorausgehen muss, also ein neues Paradigma. Da stellt sich die Frage, wann eine Wissenschaft für ein neues Paradigma reif ist und wie der Paradigmenwechsel vor sich geht.
Zu einem Paradigma gehört vor allem eine bestimmte Zahl von Annahmen, Prinzipien und Methoden, welche die Wissenschaftler zur Grundlage - zur axiomatischen Basis - ihrer Forschung machen. Erst diese Grundlagen machen eine systematische Forschung - und die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern - möglich. Als ein logischer Rahmen bestimmen sie, was empirisch beobachtet und erforscht werden soll, welche Ergebnisse als relevant gelten können und wie diese interpretiert werden dürfen. Die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft sind immer sehr abstrakt. Als solche sind sie sozusagen ziemlich leer oder nackt - und haben schließlich kaum einen Bezug zu den empirischen Tatsachen, was einen sehr wichtigen theoretischen Vorteil hat. Als solche lassen die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft viele freie analytische Räume für Generierung und Implementierung neuer Begriffe und logischer Muster. Solange die Forschung diese freien Räume mit Inhalten füllt, was in der ursprüngliche Phase der Entwicklung eines neuen Paradigmas der Fall ist, spricht man von „normaler Wissenschaft“ (Thomas Kuhn).
Es gibt aber nur bestimmte Typen von Begriffen und Zusammenhängen, die sich ohne Verletzung der logischen Konsistenz im Rahmen eines Paradigmas analytisch generieren und implementieren lassen, mit anderen Typen geht das jedoch nicht. Dies macht die „normale Wissenschaft“ hilflos, wenn sie in ihrer Forschung auf neue Tatsachen oder neue Zusammenhänge zwischen den Tatsachen stößt. Für sie bietet das gültige Paradigma keinen freien Raum. Diesen Stand hat die Forschung erreicht, wenn die Wissenschaftler von Anomalien oder Paradoxen sprechen. Was lässt sich dann tun? Um die „normale Wissenschaft“ bzw. das alte Paradigma zu retten, greift man zuerst nach Ad-hoc-Hypothesen. Man erhofft sich, mit ihnen würde man den logischen Rahmen, innerhalb dessen das Paradigma noch seine Gültigkeit behält, breiter machen können. Das kann aber nicht gelingen. Die Ad-hoc-Hypothesen bedeuten keinen wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Durch sie wird eine Wissenschaft beliebig.
Diese Beliebigkeit einer durch Ad-hoc-Hypothesen überfrachteten Wissenschaft ist sogar von einem Laien leicht zu erkennen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zerrissen. Sie bietet eine große Zahl von theoretisch „richtigen“ Vorschlägen, um ein konkretes Problem zu lösen, die im Nachhinein alle scheitern, und eine große Zahl von „richtigen“ Prognosen über die Zukunft, die sich alle als falsch erweisen. Die sich häufenden Paradoxe und das folgende Wetteifern der Fachleute um bessere Ad-hoc-Hypothesen ist ein sicheres Zeichen, dass eine Wissenschaft degeneriert (Imre Lakatos). Dann bleibt einer seriösen Wissenschaft nichts anderes übrig, als sich von der alten paradigmatischen Grundlage zu verabschieden und sich nach einer völlig neuen umzuschauen. Hat man sie gefunden, kann der nächste Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Paradigma wird aus der Wissenschaft entweder gänzlich verstoßen (Thomas Kuhn) oder von dem neuen eingewickelt (Gaston Bachelard). |
 |
| |
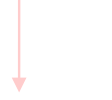 |
Sind die wichtigsten ökonomischen Lehren und Doktrinen - zumindest die bekanntesten, also jene mit zahlreichen treuen Anhängern - wirkliche wissenschaftliche Paradigmen? Nach meiner festen Überzeugung genügt nur die frühliberale Lehre der natürlichen Ordnung den strengen Ansprüchen eines wirklichen wissenschaftlichen Paradigmas. Alle späteren Versuche, diese frühliberale Lehre wesentlich nachzubessern oder sie zu ersetzen, greifen nicht weit genug. Sie sind keine richtigen Paradigmen, weil ihnen entweder ein richtiger Bezug zur Realität fehlt (Marxismus, Neoliberalismus) oder weil ihre analytischen Grundlagen zu dürftig sind (Ordoliberalismus, Keynesianismus). Aber wir müssen uns mit dem abfinden, was uns zur Verfügung steht. Angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft noch erschreckend erfolglos und rückständig ist, können wir auch nicht so streng mit ihren „Paradigmen“ sein.
Ist die neoliberale Gleichgewichtstheorie ein richtiges Paradigma?
Die neoklassische oder, wie ich sie im Folgenden nennen werde, die neoliberale Theorie war keine eigene Schöpfung der Wirtschaftswissenschaft. Die Begründer des Neoliberalismus, die zwei spitzfindigen Maschinenbauingenieure Léon Walras (1834-1910) und Vilfredo Pareto (1848-1923) haben einfach ein bereits längst bekanntes Paradigma (Modell) der klassischen Physik abgekupfert. Sie sind stillschweigend von den damaligen, weit verbreiteten Meinung ausgegangen, dass der Urvater der klassischen Physik, Isaac Newton, in seiner „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“ erklärt hat, wie die ganze Realität - sowohl die Natur als auch der Mensch - wirklich funktioniert, und haben schließlich nach dieser Philosophie ihr so genanntes Modell des allgemeinen Gleichgewichts aufgebaut.
Auf den Punkt gebracht: Die neoliberale Theorie ist in Wahrheit ein Relikt aus den Zeiten der Postkutsche und der Dampflok. Aber die Unfähigkeit der Ökonomen nach Smith, eigene Ideen zu entwickeln, so dass man fremde klauen musste, wäre nur ein Schönheitsfehler der Wirtschaftswissenschaft, wenn es funktionieren würde. Für eine seriöse Wissenschaft zählt letztendlich nur, ob sie Tataschen vorhersagen oder verwirklichen kann. Die neoliberale Theorie kann dies aber bis heute nicht. Anders als in der Physik, wo man vorerst mit dem partikel-mechanischen Modell große Erfolge feiern konnte, hat dieses Modell in der neoliberalen Theorie nie etwas gebracht.
Es ist sicher interessant, dass die Physik später ihr partikel-mechanisches Modell für immer verstoßen hat. Einerseits wurde es durch die Quantentheorie (Mikrophysik) und andererseits durch die Einsteinsche Relativitätstheorie (Makrophysik) ersetzt. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass die Paradigmenwechsel in der ökonomischen Theorie und in der Physik fast gleichzeitig stattgefunden haben, jedoch mit einem genau umgekehrten Vorzeichen: Die Physiker haben sich von dem partikel-mechanischen Modell verabschiedet, die Ökonomen haben es gerade entdeckt und in ihm der Weisheit letzten Schluss gesehen.
Da die analytischen Mittel der Theorie der klassischen Mechanik aus der Mathematik stammen, ist auch das neoliberale Gleichgewichtsmodell vornehmlich eine mathematische Schöpfung. Dies hat das intellektuelle Prestige der ökonomischen Theorie immens gesteigert. Diese künstlerische Beherrschung der Mathematik abseits der Realität bleibt aber bis heute das Einzige, worauf die neoliberale Theorie stolz sein kann. So betrachtet, also rein formal, war die neoliberale Wende mit der Übernahme des partikel-mechanischen Modells der klassischen Physik ein Paradigmenwechsel, jedoch kein wissenschaftlicher. Es handelte sich um nichts anderes als um eine ideologische Strategie zur Rechtfertigung und Propagierung der uneingeschränkten Herrschaft des Kapitals und der Wirtschaft. Die neoliberale Theorie war kein ernsthafter Versuch, um irgendwelche ökonomischen Probleme zu lösen, sondern um „Schuldigen“ vorzuführen. Die freie Markwirtschaft sollte als eine in jeder Hinsicht perfekt funktionierte Ordnung präsentiert werden, welche vom dummen und gierigen Lohnempfänger gestört und manchmal sogar zum Absturz gebracht wird.
In den folgenden Beiträgen wollen wir das totale wissenschaftliche Versagen der neoliberalen Theorie ausführlich darlegen, untersuchen und beweisen. Sie ist zwar in einer recht komplizierten mathematischen Sprache verfertigt, wir können uns aber - wie bereits angedeutet - diese Mathematik sparen. Alles was dieses Modell zu sagen hat, werden wir aus einem einfachen Beispiel entnehmen können. Dieses Musterbeispiel soll verdeutlichen, wie der Warentausch stattfindet. Damit haben wir schon etwas expliziert, was für die neoliberale Theorie bzw. ihr Paradigma von grundlegender Bedeutung ist: Tausch. Schon hier ist die paradigmatische Wende deutlich sichtbar. Im Zentrum der Interessen der ökonomischen Theorie davor - die Marxsche eingeschlossen -, stand nämlich nicht der Tausch, sondern die Produktion. Deshalb hatte es auch einen Sinn, die Politische Ökonomie, wie man noch im 19. Jahrhundert die Wirtschaftswissenschaft nannte, in Ökonomik zu umbenennen. Es gab auch Vorschläge, die neue Theorie bzw. das Paradigma als Katallaktik zu bezeichnen, nach dem klassischen griechischen katallattein mit der Bedeutung „tauschen“ oder „Handel treiben“. Diese (bessere) Bezeichnung hat sich jedoch nicht durchgesetzt.
Ein illustratives Musterbeispiel über die Optimierungsfähigkeiten des freien Marktes
Wie findet ein Tausch statt und was bedeutet er? Um es herauszufinden, unternehmen wir - im Rahmen unseres Musterbeispiels - einen gedanklichen Besuch in einem Gefangenenlager. Stellen wir uns vor, es wurden nach einem Krieg 100 Soldaten gefangen genommen. Die Verhandlungen zwischen den sich bekriegenden Seiten ziehen sich in die Länge, so dass das Gefangenenlager Versorgungsprobleme bekommt und somit auf die Unterstützung von draußen angewiesen ist. Eine karitative Organisation spendet ihm 100 Päckchen: ein Päckchen für jeden Gefangenen. In jedem von ihnen befinden sich folgende Bedarfsartikel:
5 Fleischkonserven, 10 Milchpulverdosen, 10 Würstchen, 10 Zigarettenschachteln, 2l Wein, 50 Zuckerwürfel, 5 Rasiermesser, 15 Teebeutel, ...
Alle Gefangenen freuen sich natürlich über solche Geschenke, aber nicht alle sind ganz zufrieden. Die Nichtraucher und die Abstinenten murren am lautesten. Sie haben in ihrem Sortiment auch Güter, die sich nicht brauchen können. Es dauert nicht lange, da kommen andere Gefangene auf sie zu und schlagen ihnen vor, mit ihnen zu tauschen. Die anderen Gefangenen fanden dies interessant und auch für sie selbst nützlich und so haben auch sie begonnen, die Güter aus ihren Päckchen untereinander zu tauschen. Der Lagerhof hat sich in einen Marktplatz verwandelt, auf dem gefeilscht und gehandelt wurde, was das Zeug hält. Der Lagerleiter hat dieses „anarchische“ Treiben von der Seite interessiert beobachtet, aber ohne einzuschreiten. In seinem Bericht hat er später folgendes festgehalten.
- Zwei Gefangene haben sich an dem Tausch gar nicht beteiligt, weil sie der Meinung waren, sie würden damit den Geschenkgeber beleidigen.
- Drei weitere Gefangene waren zwar gewillt zu tauschen, es schien ihnen aber kein Angebot günstig genug zu sein, so dass sich bei ihnen nichts geändert hat.
- Die übrigen fünfundneunzig Gefangenen haben in einem kleineren oder größeren Umfang ihr ursprüngliches Sortiment ausgetauscht.
Der Lagerleiter hat daraus folgende Schlussfolgerung gezogen:
Eine überwältigende Mehrheit der Gefangenen hat ihre ursprüngliche Lage mehr oder weniger verbessert. Es gab aber keinen einzigen, der nach dem Tausch schlechter als davor dastand. Fast alle Gefangenen (95) waren Gewinner, Verlierer war kein einziger. Der Tausch hat der ganzen Gruppe nur gut getan. Er hat den gesamten Nutzen der Gruppe maximiert.
Der Lagerleiter hat in seinem Bericht genau das zum Ausdruck gebracht, was in der neoliberalen Theorie unter dem pareto-optimalen Zustand verstanden wird. Diese Art von Optimum wurde nach dem bereits erwähnten Ökonomen Pareto benannt. Er hat als erster in einer allgemeinen mathematischen Sprache und mit üblichen mathematischen Mitteln nachgewiesen, dass der freie Tausch genau zu einem solchen Ergebnis führt. Der Tausch hat also eine Situation zum Ergebnis, „in der es nicht mehr möglich ist, jemanden besser zu stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen“. Eine solche Situation ist folglich die optimale.
Aber auf dem wirklichen Markt werden nicht nur Güter, also Konsum- und Produktionsgüter, getauscht, sondern auch Dienstleistungen. Da stellt sich die Frage, ob auch der Tausch der Dienstleistungen zu einem pareto-optimalen Zustand führen würde. Dies ist deshalb für die ökonomische Theorie von immenser Bedeutung, weil in einer Wirtschaft nicht nur getauscht, sondern auch produziert wird. Nehmen wir als Beispiel Arbeitskraft. Auf den ersten Blick wird der Arbeitnehmer mit seiner Arbeitskraft genauso umgehen wie mit seinen Gütern. Er bietet seine Arbeitskraft jedem (Arbeitgeber) an und entscheidet sich für den Arbeitgeber, der bereit ist mehr zu zahlen. Auf diese Weise würde er sein Einkommen optimieren - also maximieren. Und was ist mit demjenigen, der keinen Arbeitsplatz findet? Der kann zwar nichts optimieren bzw. maximieren, hat aber trotzdem nichts verloren: er hat nur nichts gewonnen. Daraus lässt sich schließen, dass sich auch Dienstleitungen in das mathematische Modell des allgemeinen Gleichgewichts implementieren lassen. Das ursprüngliche Tauschmodell hat sich also als geräumig genug auch für die Produktion erwiesen. Das neue ökonomische Modell kann also die ganze Wirtschaft abbilden. Die alten Produktionstheorien der liberalen Vorgänger würde man also nicht mehr brauchen. Daraus wurde gefolgert, dass der Markt bzw. der freie Warentausch eine universelle Form des menschlichen Handelns ist, durch das jeder Mensch fast immer und fast in jeder Hinsicht gewinnen wird, auf keinen Fall kann jemand verlieren. Der Markt sei eine göttliche Erfindung, würde man fast sagen - zumindest auf den ersten Blick scheint dem so zu sein.
Werfen wir noch einen Blick auf den Bericht des Lagerleiters mehrere Monate später. Die gleiche karitative Organisation war noch ein paar Mal da und brachte immer die gleichen Geschenke. Dem wachen Auge des Lagerleiters, der immer alles verfolgte, konnte noch etwas nicht entgehen, und auch das schrieb er in seinem Bericht nieder:
Durch den Tausch haben sich zwischen den ausgetauschten Gütern feste quantitative Verhältnisse herausgebildet:
1 Fleischkonserve = 4 Würstchen = 4 Milchpulverdosen = 2 Zigarettenschachteln = 1l Wein = 40 Zuckerwürfel = 1 Rasiermesser = 20 Teebeutel = ...
Es ließ sich auch feststellen, dass sich jeder neue Tausch schneller und einfacher abgewickelt hat als der vorige. Wer etwas tauschen wollte, musste folglich später nicht mehr mit jedem mühsam verhandeln und feilschen, weil es sich herumgesprochen hat, dass die Güter nach bestimmten festen Proportionen ausgetauscht werden - wie es eben die Gleichung oben ergibt.
Ein Fachökonom, der später der Bericht des Lagerleiters zufällig in die Hände kam, fügte am Rande hinzu:
„Ja, der Tausch bestimmt automatisch und spontan relative Preise, die so sind, dass durch sie der Nutzen jedes Marktteilnehmers optimiert (maximiert) wird. Man bezeichnet sie auch als Gleichgewichtspreise, weil sie nachhaltig für den optimalen Zustand des Marktes sorgen.“
|
|
|
| |
|
|
|
|