| |
| | | blättern ( 1 / 8 ) |  |
| |
Das Denkmuster, nach dem der klassische Nachfragetheoretiker die Welt begreift |
| |
Die paradigmatischen Grundlagen der klassischen bzw. monetären Theorie |
| |
|
|
|
Alle wichtigen Lehren oder Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft - heute sagt man einfach Theorien - sind Produkte der europäischen Moderne, genauer gesagt ihrer rationalistischen Philosophie. Nach dieser Philosophie sollte sich die ganze Realität mit einer bestimmten Zahl von universal und zeitlos geltenden Prinzipien bzw. logischen Mustern erklären lassen. Dieser rationalistischen Auffassung folgend, muss eine jede Wissenschaft ein System, d. h. ein nach bestimmten Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein (Kant). Eine solche Auffassung von Wissenschaft scheint uns heute so selbstverständlich, als ob dies schon immer so gewesen sein müsste. Das trifft natürlich nicht zu, im Gegenteil. Diese Auffassung ist eine sehr junge Errungenschaft des menschlichen Geistes und zugleich eine radikale Wende in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. In der vormodernen Zeit hat man mit Lehren oder Doktrinen etwas andres gemeint, nämlich ein loses Bündel aus Erfahrungen, Überlieferungen, Wahrnehmungen, Mythen, Empfindungen, Intuitionen, … zusätzlich auch noch mit Wünschen, Erwartungen und Werten durchwoben, welche von einer Autorität ausgewählt, zusammengefügt und zu ewigen Dogmen erklärt wurden. Folglich galten neue Erkenntnisse oder Praktiken als wahr und richtig, wenn sie im Einklang mit diesen Dogmen standen, worüber ebenfalls die Autoritäten zu entscheiden hatten.
Die rationalistische Denkweise der modernen Wissenschaften hat sich sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht als dermaßen erfolgreich erwiesen, wie man es früher nicht einmal träumen konnte. Mit ihr ließen sich umfangreiche und detaillierte Kenntnisse über die Natur gewinnen, die sich in der Praxis sehr einbringlich anwenden ließen. Dank ihnen konnte die Produktivität dermaßen schnell und kräftig steigern, wie es in der Geschichte noch nie zuvor der Fall war. Der frühmoderne Rationalismus schien deshalb auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.
Gerade in den erfolgreichsten (Natur-)Wissenschaften hat sich herausgestellt, dass sich neue Bereiche der Realität bzw. neue empirische Tatsachen nur mit neuen Denkweisen erschließen lassen, die aber mit den gewohnten Denkweisen kein widerspruchsfreies Ganzes bilden können. Seitdem wissen wir, dass man logisch nicht auf nur eine einzige Weise denken kann. Dies war das endgültige Ende der maximalistischen Ansprüche des neuen Rationalismus und seiner Vorstellung von einem geschlossenen Erkenntnissystem, das für die ganze Welt gültig wäre. Das rationalistische Wissen zerfiel in partielle und autonome Denksysteme, die untereinander nicht mehr kommensurabel („kompatibel“) sind. Heute bezeichnet man sie als wissenschaftliche Paradigmen. Setzt sich ein neues Paradigma in einer Wissenschaft durch, spricht man von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Revolution oder vom Paradigmenwechsel (Thomas Kuhn).
In den Sozialwissenschaften will man trotzdem immer noch nichts von „wissenschaftlichen Revolutionen“ bzw. „Paradigmenwechseln“ wissen. Vor allem in der Wirtschaftswissenschaft nicht, die übrigens wie kaum eine andere in den letzten zwei Jahrhunderten theoretisch steril und praktisch erfolglos blieb. Deshalb habe ich es für notwenig gehalten, am Anfang dieses thematischen Bereichs mit dem Schwerpunkt Das Elend der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung: ,
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Leser, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung:
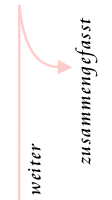 |

Wie bereits angedeutet, haben die Philosophen am Anfang der Moderne von der Ratio zu viel erwartet. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist die reale Welt zu komplex für die logischen Erklärungssysteme, die sich der homo sapiens ausdenken kann. Wir können uns zwar vorstellen, dass im Kopf des Allmächtigen das ganze Universum, bis ins letzte Detail, ein einziges, in sich schlüssiges logisches System sein kann, aber der Kopf des Menschen ist für ein solches System offensichtlich zu klein. Dies hätte eigentlich schon deutlich sein müssen, als sich feststellen ließ, dass die neu entstandenen Wissenschaften ihre eigenen Theorien und Methoden - jede Wissenschaft für sich allein - entwickelten, um den von ihnen abgegrenzten kleinen Bereich der Wirklichkeit zu erforschen. Wenn eine universelle Wissenschaft möglich wäre, müssten sich die speziellen Wissenschaften um solche eigenen Theorien und Methoden nicht kümmern.
Das alles wollte man aber vorerst übersehen und die nahe liegenden Schlüsse nicht ziehen. Es ist aber verständlich. Als die modernen Wissenschaften gerade entstanden sind, war es nicht abwegig eine Zeitlang abzuwarten und hoffen, dass zumindest innerhalb dieser speziellen Wissenschaften immer gleiche Denkweisen gelten würden, so dass die Wissenschaftler ihre Fortschritte immer weiter, sozusagen linear und kumulativ, machen würden. Es kam aber anders. Allmählich wurde es immer deutlicher, dass sich auf den gleichen analytischen Grundlagen doch nicht immer weitere Fortschritte machen lassen. Die Theorien sind sozusagen nicht dermaßen belastbar, dass man auf sie immer weiter und höher aufbauen kann. Wie oben ebenfalls angedeutet, hat man diese schmerzhafte Erfahrung gerade in der erfolgreichsten Naturwissenschaft, in der Physik, zuerst gemacht: Man erinnert sich an die Relativitätstheorie von Einstein, die schon einiges in der Welt der klassischen Physik durcheinander gebracht hat. Die Quantenphysiker danach haben dann so ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Danach wurde es unmöglich, sich vor der befürchteten Konsequenz zu drücken, dass es nicht einmal in den speziellen Wissenschaften möglich ist, rationale Grundlagen zu schaffen, die für alle Zeiten gültig wären. Das Alte muss von Zeit zu Zeit geopfert werden, weil es mit dem Neuen nicht kommensurabel ist. Der geschlossene Rationalismus vom Anfang der Moderne, ich bezeichne ihn auch als Monologizismus, war also eine Anmaßung. Er war es auch noch in einer anderen Hinsicht.
Unterstreichen wir noch einmal, dass es die praktischen, also im strengsten Sinne empirischen Erfolge waren, die bei den rationalistischen Philosophen der Moderne maximalistische Hoffnungen weckten, sie würden die ganze Realität in ein einzigeslogisch widerspruchsfreies System packen können. Gerade diese empirischen Erfolge haben die unvorsichtigen Rationalisten am Anfang der Moderne zu dem gewagten Gedanken verführt, dass das „richtige“ Denken mit der Realität identisch, oder zumindest sozusagen ein genauer Spiegel des Seienden wäre. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es nicht einmal im Rahmen einer einzelnen Wissenschaft eine für alle Zeiten richtige Denkweise gibt, kann man sich nun sicher sein, dass das rationale Denken die Realität, wie sie „wirklich ist“, also das sogenannte „Ding an sich“ (Kant) nie erreichen kann. Seitdem lässt sich nicht mehr daran zweifeln, dass sich die rationalen Schlussfolgerungen nur auf die Oberfläche der Realität beziehen können, also auf das, was unseren - nicht besonders empfindlichen und präzisen - Sinnen zugänglich ist. Das nennt man Tatsachen. Für einen Philosophen kann dies enttäuschend wenig sein, aber für die Existenz des Menschen reicht ein solches Wissen - über die Tatsachen - doch völlig aus. Die Wissenschaften können also auch nach dem Zerfall des alten geschlossenen Rationalismus weitermachen wie bisher, nur müssen sie sich der Notwendigkeit bewusst sein, dass ihren neuen Durchbrüchen, also der Eroberung von neuen „Schichten“ der Tatsachen, immer eine Änderung der Denkweise vorausgehen muss, also ein neues Paradigma. Da stellt sich die Frage, wann eine Wissenschaft für ein neues Paradigma reif ist und wie der Paradigmenwechsel vor sich geht.
Zu einem Paradigma gehört vor allem eine bestimmte Zahl von Annahmen, Prinzipien und Methoden, welche die Wissenschaftler zur Grundlage - zur axiomatischen Basis - ihrer Forschung machen. Erst diese Grundlagen machen eine systematische Forschung - und die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern - möglich. Als ein logischer Rahmen bestimmen sie, was empirisch beobachtet und erforscht werden soll, welche Ergebnisse als relevant gelten können und wie diese interpretiert werden dürfen. Die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft sind immer sehr abstrakt. Als solche sind sie sozusagen ziemlich leer oder nackt - und haben schließlich kaum einen Bezug zu den empirischen Tatsachen, was einen sehr wichtigen theoretischen Vorteil hat. Als solche lassen die paradigmatischen Grundlagen einer Wissenschaft viele freie analytische Räume für Generierung und Implementierung neuer Begriffe und logischer Muster. Solange die Forschung diese freien Räume mit Inhalten füllt, was in der ursprüngliche Phase der Entwicklung eines neuen Paradigmas der Fall ist, spricht man von „normaler Wissenschaft“ (Thomas Kuhn).
Es gibt aber nur bestimmte Typen von Begriffen und Zusammenhängen, die sich ohne Verletzung der logischen Konsistenz im Rahmen eines Paradigmas analytisch generieren und implementieren lassen, mit anderen Typen geht das jedoch nicht. Dies macht die „normale Wissenschaft“ hilflos, wenn sie in ihrer Forschung auf neue Tatsachen oder neue Zusammenhänge zwischen den Tatsachen stößt. Für sie bietet das gültige Paradigma keinen freien Raum. Diesen Stand hat die Forschung erreicht, wenn die Wissenschaftler von Anomalien oder Paradoxen sprechen. Was lässt sich dann tun? Um die „normale Wissenschaft“ bzw. das alte Paradigma zu retten, greift man zuerst nach Ad-hoc-Hypothesen. Man erhofft sich, mit ihnen würde man den logischen Rahmen, innerhalb dessen das Paradigma noch seine Gültigkeit behält, breiter machen können. Das kann aber nicht gelingen. Die Ad-hoc-Hypothesen bedeuten keinen wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Durch sie wird eine Wissenschaft beliebig.
Diese Beliebigkeit einer durch Ad-hoc-Hypothesen überfrachteten Wissenschaft ist sogar von einem Laien leicht zu erkennen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zerrissen. Sie bietet eine große Zahl von theoretisch „richtigen“ Vorschlägen, um ein konkretes Problem zu lösen, die im Nachhinein alle scheitern, und eine große Zahl von „richtigen“ Prognosen über die Zukunft, die sich alle als falsch erweisen. Die sich häufenden Paradoxe und das folgende Wetteifern der Fachleute um bessere Ad-hoc-Hypothesen ist ein sicheres Zeichen, dass eine Wissenschaft degeneriert (Imre Lakatos). Dann bleibt einer seriösen Wissenschaft nichts anderes übrig, als sich von der alten paradigmatischen Grundlage zu verabschieden und sich nach einer völlig neuen umzuschauen. Hat man sie gefunden, kann der nächste Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Paradigma wird aus der Wissenschaft entweder gänzlich verstoßen (Thomas Kuhn) oder von dem neuen eingewickelt (Gaston Bachelard). |
 |
| |
 |
ind die wichtigsten ökonomischen Lehren und Doktrinen - zumindest die bekanntesten, also jene mit zahlreichen treuen Anhängern - wirkliche wissenschaftliche Paradigmen? Nach meiner festen Überzeugung genügt nur die frühliberale Lehre der natürlichen Ordnung den strengen Ansprüchen eines wirklichen wissenschaftlichen Paradigmas. Alle späteren Versuche, diese frühliberale Lehre wesentlich nachzubessern oder sie zu ersetzen, greifen nicht weit genug. Sie sind keine richtigen Paradigmen, weil ihnen entweder ein richtiger Bezug zur Realität fehlt (Marxismus, Neoliberalismus) oder weil ihre analytischen Grundlagen zu dürftig sind (Ordoliberalismus, Keynesianismus). Aber wir müssen uns mit dem abfinden, was uns zur Verfügung steht. Angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft noch erschreckend erfolglos und rückständig ist, können wir auch nicht so streng mit ihren „Paradigmen“ sein.
Ist die klassische oder monetäre Nachfragetheorie ein richtiges Paradigma?
Die alte Nachfragetheorie, die ich auch als klassisch bezeichne, entwickelte sich als eine Reaktion auf den unerträglichen Widerspruch zwischen dem, was die marktgläubigen liberalen Ökonomen theoretisch vorexerzieren und den empirischen Tatsachen. Aber das ist noch nichts Besonderes. Die Kritik steht nicht selten auch am Anfang eines neuen Paradigmas bei den Naturwissenschaften. Sie hilft, die Probleme richtig kennen zu lernen. Aber im nächsten Schritt verlassen die Naturwissenschaftler die Kritik und suchen nach theoretischen Lösungen. Manchmal gelingt es ihnen die Probleme nur außerhalb des gewohnten Denksystems zu lösen, woraus sich Grundlagen für eine neue Denkweise bzw. ein neues Paradigma entwickeln. Die Sozial- und vor allem die Wirtschaftswissenschaftler haben andere „Gewohnheiten“. Sie können von ihrer Kritik so eingenommen und begeistert werden, dass sie einfach vergessen, Lösungen zu suchen, oder noch schlimmer, sie funktionieren die Kritik zur Klage um. So ist für Marx der Kapitalist und bei den Neoliberalen der gierige Lohnempfänger die einzige Ursache aller Probleme. Und diese modernen Inquisitoren maßen sich auch noch an, sich Wissenschaftler zu nennen.
Den klassischen Nachfragetheoretikern kann man zumindest nicht vorwerfen, sie haben abseits der Realität ihre Theorie getrieben. Der erste bedeutende Nachfragetheoretiker Sismondi hat sogar versucht, mit seiner dynamischen Analyse ein neues analytisches Modell für die Funktionsweise der Marktwirtschaft zu entwerfen, und innerhalb dessen den Nachfragemangel zu erklären. Genau so muss man vorgehen, wenn man ein neues Paradigma statuieren will. Aber sein Versuch war leider nicht erfolgreich. Die Nachfragetheoretiker nach ihm wagten dann nicht mehr neue analytische Grundlagen für die Funktionsweiße der Marktwirtschaft zu formulieren, oder wie man heute sagt, den Nachfragemangel mikroökonomisch zu fundieren. Sie sind in der Kritik des Sayschen „Gesetzes“ stecken geblieben. Mit diesem „Gesetz“, das eigentlich kein Gesetz ist, haben nämlich die marktgläubigen Ökonomen ein Jahrhundert nach Adam Smith, bis sich das neoliberale Gleichgewichtsmodell durchgesetzt hat, das angeblich spontane Streben der Marktwirtschaft zum Gleichgewicht analytisch begründet und verteidigt.
Ohne Besitz eines eigenen Referenzmodells über die Marktwirtschaft blieb den klassischen Nachfrageökonomen nichts anderes übrig, als ihre Baustelle am Rand des Sayschen „Gesetzes“ bzw. des neoliberalen Gleichgewichtsmodells zu verlegen und ihre theoretischen Bauwerke auf psychologische Fundamente zu stellen. Sie haben für die Probleme der Marktwirtschaft das falsche Verhalten bestimmter Wirtschaftsakteure verantwortlich gemacht. Ein bisschen zugespitzt gesagt, sie haben durch Einräumung menschlicher Schwächen die Marktwirtschaft freigesprochen, auch wenn dies alles andere als ihre Absicht war. Deshalb hat keiner richtig verstanden, warum sie so gegen das Saysche „Gesetz“ waren.
Das falsche Verhalten betrifft in der klassischen Nachfragetheorie aber nicht den Bereich der Produktion; es bezieht es sich nicht etwa auf falsche Entscheidungen über Investitionen, die zu realen strukturellen Disproportionalitäten oder „Friktionen“ führen. Solche und ähnliche Fehlentscheidungen wurden nämlich auch von den radikalsten Anhängern der freien Marktwirtschaft nie bestritten. Es wäre in der Tat naiv, falsche Entscheidungen der Investoren für alle Probleme der Marktwirtschaft verantwortlich zu machen. So etwas lässt sich nicht empirisch nachweisen. Bei konjunkturellen Einbrüchen und wirtschaftlichen Krisen lässt sich nämlich nie feststellen, dass man von einigen Gütern zu viel und von den anderen zu wenig produziert, sondern es gibt von allen Produkten zu viel. Dies bezeichnet man auch als allgemeine Überproduktion (general glut). Sie würde angeblich durch die übertriebene Neigung der Menschen, zu viel zu sparen bzw. das Geld zu horten, verursacht. Darin bestünde, so die klassischen Nachfragetheoretiker, das falsche Verhalten der Menschen, das für alle Probleme der Marktwirtschaft verantwortlich wäre. Wie wir in unserm illustrativen Musterbeispiel sehen werden, zu viel sparen bzw. zu wenig konsumieren lässt sich nur deshalb, weil es Geld gibt. Das Geld ist die tragende Säule der klassischen Nachfragetheorie, die ich deshalb auch als monetäre Nachfragetheorie bezeichne.
Ein interessantes Experiment über die fatalen Folgen der Konsumverweigerung
Schon die uralten Schriften lassen uns erfahren, dass das Geld immer eine seltsame Anziehungskraft auf die Menschen ausgeübt hat. Allerdings war früher das Geld an sich wertvoll, weil es hauptsächlich aus Gold und Silber bestand. Es ist aber schon lange her, dass man begonnen hat, Gold und Silber durch Papier zu ersetzen. Beim Geld aus Papier leuchtet es nicht sofort ein, warum es so wertvoll sein sollte, dass der Mensch begehren sollte, so viel wie möglich davon zu besitzen. Wie wir sehen werden, ist es gar nicht so einfach nachzuweisen, dass dem wirklich so ist. Trotzdem gibt es zweifellos viele Situationen, wo Menschen ihre Geldreserven doch vergrößern wollen.
Eine einfache Geschichte kann überzeugend darstellen, dass es gar nicht so irrational ist, etwas mehr zu sparen, und dass dies dann fatale Folgen haben kann. Diese Geschichte über eine Babysitting-Genossenschaft, die pleite ging, schreibt Paul Krugman, der nachfrageorientierte Ökonom und Nobelpreisträger (2008) „veränderte mein Leben“ und sie „lehrt uns etwas, das die Welt retten könnte“. Sie wurde in einem Artikel mit dem passenden Titel „Geldtheorie und die Krise der Great Capitol Hill Babysitting-Genossenschaft“ erzählt.
Eine Gruppe von jungen Akademikern - also von Menschen, denen man kein irrationales Verhalten unterstellen sollte -, etwa 150 Paare, vereinbarten, für einander babyzusitten, Das Babysitten sollte wie eine reine Tauschwirtschaft funktionieren, aber es wäre umständlich, wenn jedes Paar seine geleisteten Stunden der Babysitting von dem gleichen Paar zurückerhalten sollte. Man wählte eine recht nahe liegende Lösung. Jedes Paar, das eine Stunde bei jemandem abgeleistet hat, sollte ein Coupon bekommen, mit dem es eine Stunde von einem anderen beliebigen Paar erhalten konnte. Das lässt das System sich störungsfrei und beliebig lange selbst steuern - dachte man zumindest. Im Laufe der Zeit würde nämlich jedes Paar automatisch genauso viel babysitten, wie es dafür umgekehrt erhält. Kein Paar würde nämlich nur wegen der wertlosen Coupons babysitten wollen - dachte man zumindest. Solange diese junge Menschen zuverlässig und seriös waren - und diese ambitionierten Berufseinsteiger waren es sicherlich - was konnte schief gehen? Es zeigte sich aber sehr schnell, dass dieses einfache System doch eine kleine Macke hatte.
Jedes Paar, aus völlig verständlichen Gründen, wollte sich für unvorhersehbare Situationen absichern. Zu Zeiten, wenn es wenige Gelegenheiten hatte auszugehen, wollte es sich eine Reserve anlegen, um sie erst dann abzubauen, wenn sich die günstigen Gelegenheiten zum Ausgehen ergeben würden. Dieses Verhalten war natürlich vorgesehen und erlaubt, und es lässt sich daran nichts Unmoralisches aussetzen. Natürlich lag es jedem Paar ganz fern, die Coupons einfach so zu sammeln. Solche Anziehungskraft besaßen diese ziemlich schäbigen Papierstücke nicht. Aber - wie es im Leben so vorkommt - schon ein so harmloser Umstand wie das schlechte Wetter hat viele Paare veranlasst nicht auszugehen, sondern selber babyzusitten. So entstand ein Ungleichgewicht: Dem Angebot fehlte die Nachfrage. Am Anfang ließ sich mit mehr Engagement („Flexibilität“) etwas tun: Man konnte telephonisch bei allen offerieren und mit gewissen Überzeugungsstrategien ein bisschen mehr erreichen, aber auch der sympathischste und der überzeugendste Anbieter konnte seine rhetorischen Künste nicht beliebig lange einsetzen, wollte er sich nicht als allzu aufdringlich unbeliebt machen. Deshalb wurde das Ungleichgewicht immer größer. Das war die kleine Macke des sich selbst regelnden „Systems“ mit fatalen Folgen. Irgendwann lief nichts mehr. Es herrschte eine allgemeine Überproduktion. Was tun?
Wir brauchen diese Geschichte nicht weiter zu verfolgen. Uns reicht die völlig berechtigte Schlussfolgerung, dass nicht einmal der ganz einfache freie Markt mit rational eingestellten Menschen funktionsfähig sein muss. Das mikroökonomisch rationale Verhalten reicht also noch nicht aus, dass auch das Ganze rational und vor allem nachhaltig funktioniert. Schon hier, an einem recht einfachen Beispiel des freien Marktes leuchtet uns ein, warum der erste ökonomische Liberale Thomas Hobbes für uneingeschränkte ökonomische Freiheit war, aber zugleich auch einen totalitären Staat beanspruchte. Aber das ist hier nicht unser Thema.
Noch etwas lässt sich aus unserem einfachen Beispiel unmittelbar entnehmen. Die Konsumverweigerung, die zum Ungleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nachfrage führt, weil ein Nachfragemangel entstanden ist, wurde nur deshalb möglich, weil man die Coupons sammeln konnte. Die Coupons waren hier im Prinzip nichts anderes als eine Art von Geld, so dass die klassische Nachfragetheorie auf die ein oder andre Weise mit dem Geld steht und fällt - möge dieses auch noch so unecht und fiktiv sein.
|
|
|