| |
| | | blättern ( 1 / 21 ) |  |
| |
über die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Paradigmenwechsels |
| |
Der aktuelle Stand der ökonomischen Theorie in einer Kurzfassung |
| |
|
|
|
Alle wichtigen Lehren oder Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft - heute sagt man einfach Theorien - sind ein Produkt der europäischen Moderne, genauer gesagt ihrer rationalistischen Philosophie. Nach dieser Philosophie sollte sich die ganze Realität mit einer bestimmten Zahl von universal und zeitlos geltenden Prinzipien (logischen Mustern) vollständig erklären lassen. Nach solcher rationalistischen Vorstellung kann bzw. muss eine jede Wissenschaft ein System, d. h. ein nach bestimmten Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnisse sein. Diese Auffassung von Wissenschaft scheint uns heute so selbstverständlich zu sein, als ob es schon immer so gewesen sein müsste. Sie ist jedoch eine sehr junge Errungenschaft des menschlichen Geistes und zugleich eine radikale Wende in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. In der vormodernen Zeit hat man nämlich unter den Lehren oder Doktrinen ein loses Bündel aus Erfahrungen, Empfindungen und Intuitionen verstanden, welche von einer Autorität ausgewählt, zusammengestellt und zu Dogmen erklärt worden sind. Folglich galten neue Erkenntnisse oder Praktiken als wahr und richtig, wenn sie im Einklang mit diesen Dogmen standen, worüber ebenfalls die Autoritäten entschieden haben.
Diese rationalistische Denkweise bei den modernen Wissenschaften hat sich als fast unglaublich erfolgreich erwiesen. Sie lieferte umfangreiche und detaillierte Kenntnisse über die Natur, von denen man früher nicht einmal zu träumen wagte. Angesichts dieser Erfolge fühlte sich die rationalistische Philosophie, und zwar völlig zu Recht, in ihren maximalistischen Ansprüchen großartig bestätigt. Es sah vorerst wirklich so aus, als ob die ganze Realität in ein einziges logisch widerspruchsfreies System passen würde. Das Gedachte schien eine treue Spiegelung des Seienden zu sein. Der frühmoderne Rationalismus schien auf der ganzen Linie gesiegt zu haben. Und dann geschah etwas Unvorstellbares.
Die neuen, der Ratio verpflichteten (Natur-)Wissenschaften gingen ihren eigenen rationalistischen Weg weiter und da stellte sich heraus, dass sich neue Bereiche der Realität bzw. neue empirische Tatsachen nur mit neuen Denkweisen erreichen lassen, die aber mit den gewohnten (mainstream) Denkweisen kein widerspruchsfreies Ganzes mehr bilden können. Dies war das endgültige Ende des geschlossenen Erkenntnissystems der Welt. Sie zerfiel in partielle und autonome Denkweisen oder Denksysteme, die untereinander nicht mehr kommensurabel („kompatibel“) sind. Heute bezeichnet man sie als Paradigmen. So entstehen immer neue Paradigmen, die mit den älteren in Wettbewerb stehen, so dass die besseren siegen, die aber bald von neu entstandenen herausgefordert werden. Setzt sich ein neues Paradigma durch, spricht man von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Revolution oder vom Paradigmenwechsel (Kuhn).
Ich bin der festen Überzeugung, dass auch die Wirtschaftswissenschaft auf keine andere Weise Fortschritte machen kann als alle erfolgreichen (exakten) Wissenschaften bisher, also nur durch „wissenschaftliche Revolutionen“ und „Paradigmenwechsel“. Die Ökonomen wollten aber davon nie etwas wissen und das hat sich immer noch nicht geändert. Deshalb habe ich es für notwenig gehalten, am Anfang dieses thematischen Bereichs, mit dem Schwerpunkt Das Elend der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
 die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Besucher dieser Website, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier rechts eine kurze Zusammenfassung:
die Problematik des wissenschaftlichen Fortschritts aus einem breiten Betrachtungswinkel zu erörtern. Für jene Besucher dieser Website, die weniger an allgemeinen erkenntnistheoretischen (und methodischen) Fragen interessiert sind oder dafür vorerst keine Zeit haben, hier rechts eine kurze Zusammenfassung:
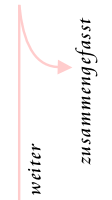 |

Es war einfach zu viel, was die Philosophen am Anfang der Moderne von der Ratio erwartet haben. Die Realität ist nämlich zu komplex für ein aus dem Kopf des homo sapiens entsprungenes logisches Erklärungssystem, das universal gelten würde. Wir müssen folglich jeder Wissenschaft erlauben, dass sie sich für ihren Forschungsbereich die am besten geeignete Denkweise auswählt und dass sie sich auch völlig neue Denkweisen aneignet, wenn sie nicht anders vorankommt. Der geschlossene Rationalismus vom Anfang der Moderne, ich bezeichne ihn auch als Monologizismus, war also eine Anmaßung, aber nicht nur das. In seiner Annahme im Sinne der Spiegelmetapher, die Realität so zu erklären, wie sie „wirklich“ ist, ist dieser Rationalismus zweifellos falsch. Das rationale Denken kann die Realität, wie sie „wirklich ist“, also das sogenannte „Ding an sich“ (Kant) nie erreichen. Die rationalen Schlussfolgerungen können sich nur auf die Oberfläche der sinneszugänglichen Tatsachen beziehen. Für einen Philosophen kann dies enttäuschend wenig sein, aber für die Existenz des Menschen reicht ein Wissen über die Tatsachen völlig aus. Insoweit tun die Wissenschaften, die ihre Aufgabe darin sehen, die Tatsachen vorherzusagen und zu verwirklichen, genau das Richtige. Sie können also auch nach dem Zerfall des alten geschlossenen Rationalismus weitermachen wie bisher, nur müssen sie sich der Notwendigkeit bewusst sein, dass für die grundlegenden Fortschritte, also für die Erklärung des früher Unerklärbaren und für die Eroberung von neuen „Schichten“ der Tatsachen, immer ein Paradigmenwechsel vorausgehen muss. Über die Notwendigkeit des Paradigmenwechsels lässt sich in aller Kürze folgendes sagen:
Zu einem Paradigma gehört vor allem eine bestimmte Zahl von Annahmen, Prinzipien und Methoden, welche die Wissenschaftler zur Grundlage ihrer Forschung machen. Erst diese Grundlagen machen eine systematische Forschung möglich. Sie bestimmen nämlich, was beobachtet und erforscht werden soll, welche Ergebnisse als relevant gelten können und wie diese interpretiert werden dürfen. Diese paradigmatischen Grundlagen sind immer sehr abstrakt. Solange man sich deduktiv noch in ihrer Nähe bewegt, ist folglich der freie Raum für die Aufnahme (Implementierung) neuer logischer Verknüpfungen und Muster noch groß. Diese ursprüngliche Phase des neuen Paradigmas, wenn seine Grundlagen noch bedeutende Verbreiterungen und Vertiefungen erlauben, nennt man „normale Wissenschaft“ (Kuhn).
Aber die paradigmatischen Grundlagen machen die Wissenschaft nicht nur möglich, sondern sie beschränken sie auch zugleich. Sie schützen sie nämlich vor all dem, was ihre innere Schlüssigkeit (Konsistenz) zerstören könnte. Dies macht die „normale Wissenschaft“ hilflos, wenn sie auf Tatsachen stößt, für die sie keine Erklärung findet. Man spricht dann von Anomalien oder Paradoxen. Um die „normale Wissenschaft“ bzw. ihr Paradigma zu retten, greift man nach Ad-hoc-Hypothesen. Aber sie bedeuten keinen wissenschaftlichen Fortschritt mehr. Sie sind nur spitzfindige Versuche, die Niederlagen zu kaschieren. Die steigende Anzahl an Paradoxen und Ad-hoc-Hypothesen ist ein sicheres Zeichen, dass eine Wissenschaft degeneriert (Lakatos), so dass dann nichts anderes übrig bleibt, als sich nach völlig neuen paradigmatischen Grundlagen umzuschauen. Hat man sie gefunden, kann der nächste Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Paradigma wird aus der Wissenschaft entweder gänzlich verstoßen (Kuhn) oder von dem neuen eingewickelt (Bachelard).
Das paradigmatische Gerüst einer Wissenschaft - in den Naturwissenschaften sagt man einfach Modell - kann sehr abstrakt sein, also weitgehend aus der formalen Logik und Mathematik bestehen. Als solches kann es dem Laien schwer zugänglich sein. Wenn es aber nicht um eine praktische und konkrete Anwendung einer Wissenschaft geht, wo es auf das letzte Detail ankommt, wenn man nicht mehr will als nur ihr Paradigma möglichst einfach und anschaulich zu erklären, braucht man nicht auf abstrakte paradigmatische Grundmuster zurückzugreifen. Man kann das „Original“ mit einem passenden Musterbeispiel ersetzen. Dieser illustrativ-metaphorische Ersatz muss natürlich gleiche Intentionen entfalten und zu gleichen Schlussfolgerungen führen. Ein solches Musterbeispiel lässt sich immer finden, auch bei den mathematisch anspruchsvollen Wissenschaften. Wir erinnern uns daran, dass es z.B. zahlreiche, für den Laien geschriebene Bücher gibt, wo man auf einleuchtende Weise sogar die Einsteinsche Relativitätstheorie erklärt bekommt. Der Leser dieser Bücher wird dadurch noch kein Physiker und Ingenieur, aber er kann sich eine grobe Vorstellung davon machen, worum es in dieser Theorie geht. Er kann zugleich erfahren, was die betreffende Theorie bzw. das Paradigma in der Praxis konkret geleistet hat. |
 |
| |
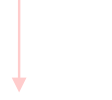 |
Sind die wichtigsten ökonomischen Lehren und Doktrinen - zumindest die bekanntesten, also jene mit zahlreichen treuen Anhängern - wirkliche wissenschaftliche Paradigmen? Nach meiner festen Überzeugung genügt nur die frühliberale Lehre der natürlichen Ordnung den strengen Ansprüchen eines wirklichen wissenschaftlichen Paradigmas. Alle späteren Versuche, diese frühliberale Lehre wesentlich nachzubessern oder sie zu ersetzen, greifen nicht weit genug. Sie sind keine richtigen Paradigmen, weil ihnen entweder ein richtiger Bezug zur Realität fehlt (Marxismus, Neoliberalismus) oder weil ihre analytischen Grundlagen zu dürftig sind (Ordoliberalismus, Keynesianismus). Aber wir müssen uns mit dem abfinden, was uns zur Verfügung steht. Angesichts der unbestrittenen Tatsache, dass die Wirtschaftswissenschaft noch erschreckend erfolglos und rückständig ist, können wir auch nicht so streng mit ihren „Paradigmen“ sein.
Brauchen wir ein neues Paradigma in der Wirtschaftswissenschaft überhaupt?
Vielleicht ist es besser, wenn wir die Frage zuerst umdrehen, um sie einfacher zu beantworten. Dann würde sie lauten: Womit müssten wir uns abfinden, wenn wir kein neues Paradigma in der Wirtschaftswissenschaft haben wollten? Aus unseren bisherigen Erfahrungen lässt sich diese Frage unschwer beantworten.
Die heute souverän herrschende neoliberale Theorie hat mit einer echten Wissenschaft nichts zu tun. Sie bezieht sich nicht auf empirisch nachprüfbare, geschweige denn messbare Tatsachen. Für das, was der wahre Sinn und Zweck jeder seriösen wissenschaftlichen Theorie ist, die Tatsachen vorherzusagen oder zu verwirklichen, ist die neoliberale Theorie nicht einmal vorgesehen. Schon ihre Begriffe sind reine Abstraktionen und Hirngespinste. Sie schweben über der Wirklichkeit wie böse Geister, in deren blutunterlaufenen Augen sich aber nicht das wahre Geschehen, sondern nur böse Wünsche und Absichten spiegeln. Wie es schon Marx sagte, die neue bürgerliche ökonomische Theorie ist nur eine weit fortgeschrittene Vulgarisierung der frühliberalen Lehre zu ideologischen Zwecken: eine Anbiederung der korrupten Bildungsbürger an die Reichen und Mächtigen. Diese brauchen sie für die Rechtfertigung ihres parasitären Daseins und ihrer psychopathischen Machtgelüste.
Die einzige wirkliche Leistung der neoliberalen Theorie besteht also in ihrer ideologischen Macht, die Menschen psychisch zu beeinflussen. Eigentlich ist sie nichts anderes als eine besondere Art der politischen Literatur, welche Wissenschaftlichkeit vortäuscht, indem sie alles, was sie suggerieren will, noch einmal in einer hochtrabenden mathematischen Sprache nacherzählt. Deshalb ist es bestimmt nicht falsch zu sagen, dass es noch nie so wenig Wissenschaft in der Wirtschaftswissenschaft gab wie heute.
Dann bleibt uns nur die Nachfragetheorie von Keynes übrig. Man wirft aber dieser Theorie vor, dass sie in den 80er Jahren endgültig versagt hat. Hat sie es wirklich? Dies hängt davon ab, nach welchem Kriterium man urteilen will. Würde man die praktischen Ergebnisse der Keynesschen Theorie mit einem idealen Zustand vergleichen, dann hat sie in der Tat versagt. Diese bösartige und heuchlerische Art, die gegnerische Theorie zu beurteilen, war schon die wichtigste und erfolgreichste ideologische Waffe gegen den Kommunismus. Es gibt aber auch andere Kriterien. Wir können nämlich die Ergebnisse der drei keynesianischen mit drei neoliberalen Jahrzehnten vergleichen. Bei diesem Kriterium kommt man dann sehr schnell zu einem eindeutigen Ergebnis:
Die ersten drei Jahrzehnte nach dem Weltkrieg, die Keynesschen Jahrzehnte, bezeichnet man als „Goldenes Zeitalter“ des Kapitalismus und zwar mit gutem Grund. Das erzielte Wachstum, die Produktivitätssteigerung, Beschäftigung, Lohnsteigerung und soziale Absicherung sowie einiges mehr hat alles übertroffen, was man je aus der Kapitalismusgeschichte kannte. In den drei neoliberalen Jahrzehnten danach sind (im Schnitt) das Sozialprodukt und das Produktivitätswachstum etwa halb so schnell gewachsen - trotz der digitalen Revolution. Die Arbeitsintensität und die Arbeitszeit sind immer weiter gestiegen, die Reallöhne aber nicht - die sind in einigen Ländern sogar gefallen. Zwischen Arm und Reich begann ein Abgrund zu klaffen. Die Beschäftigung sah manchmal nur dank der „kreativen“ Statistik gut aus: So wurde schon jemand, der nur ein paar Stunden pro Woche arbeitet, nicht mehr als arbeitslos erfasst, man hat die Arbeitslosen in verschiedenen unsinnigen Umschulungsprogrammen versteckt oder man hat sie wegen jeder Kleinigkeit eingekerkert (USA) und einiges mehr. Die öffentlichen Güter und nationalen Naturressourcen haben sich die Reichen unter den Nagel gerissen; sie picken sich die Rosinen heraus und hinter ihnen bleibt nur Zerstörung zurück, die sogar das Leben auf unserem Planeten bedroht. Die Menschen trauen sich nicht mehr, Kinder zu zeugen, und für einen großen Teil der Bevölkerung ist die Altersarmut vorprogrammiert. Trotzdem sind nicht einmal die Staatsschulden kleiner, sondern viel größer geworden. Und am Schluss dieser fatalen Entwicklung stürzte die Weltwirtschaft im Herbst 2008 in eine Rezession, wie sie es seit der Großen Depression nicht mehr gegeben hat.
Wenn aber die keynesianische Wirtschaftspolitik - relativ betrachtet - so erfolgreich war, warum wurde sie verlassen und durch eine, die deutlich weniger effizient ist, ersetzt? Handelte es sich dabei um eine Verschwörung, welche die böswilligen Reichen mit sich bei ihnen prostituierenden Wissenschaftlern in dunklen Hinterzimmern geschmiedet und dann mit Hilfe der korrupten Politiker durchgesetzt haben? Nein, Ordnungen, die nicht funktionsfähig sind, benötigen keine Verschwörer. Das beste Beispiel dafür hat uns vor einer nicht allzu langen Zeit der Kommunismus geliefert. Die Untersuchung seines Zusammenbruchs lässt ein dreistufiges Schema erkennen, nach dem das Scheitern jeder erfolglosen Ordnung abläuft: (1) zuerst will man die Probleme nicht einmal wahrnehmen, dann (2) lässt man den „Stückwerktechniker“ („Experten“ und Politiker) mit „schmerzhaften aber nötigen“ Reformen das Volk drangsalieren und (3) schließlich bricht alles zusammen. Nach drei Jahrzehnten des Keynesianismus, der zum plumpen deficit spending degenerierte, gab es zwar keinen richtigen Zusammenbruch der Marktwirtschaft, aber sein Scheitern in drei Stufen ließ sich dennoch gut beobachten.
In den 70er Jahren ließ sich nicht mehr leugnen, dass die Arbeitslosigkeit unaufhaltsam steigt und dass man etwas dagegen tun muss. Wie immer wurden die mainstream Ökonomen zu Rate gezogen - damals waren es natürlich Keynesianer. Sie haben tüchtig einen Vorschlag nach dem anderen produziert und die reformwilligen Politiker haben sie brav durchgesetzt. Diese Politiker waren zweifellos sehr mutig. Erinnern wir uns an den sozialdemokratischen Kanzler Helmut Schmidt, der wild entschlossen war, auch eine höhere Inflation in Kauf zu nehmen, um die Arbeitslosigkeit zu senken. „Lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“ - so der bekannte Spruch von ihm. Zum Schluss bekam er sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit. (Seitdem ist er zum erklärten Antikeynesianer mutiert.) Diese praktischen Misserfolge haben schließlich auch die Theorie von Keynes in Verruf gebracht. Sie hat in der Tat einige nicht unerhebliche Schwächen, die wir schon erörtert haben. Erwähnen wir nur einige:
Es kann natürlich nicht geleugnet werden, dass die Keynessche Theorie durch immer wieder feststellbare allgemeine Überproduktion und den Nachfragemangel einen empirischen Bezug zu der ökonomischen Wirklichkeit hat, von dem die angebotsorientierte Schönwettertheorie immer nur träumen konnte. Aber ihre theoretische Seite ist schwach. Die wichtigsten Annahmen der Keynesschen Theorie, die Liquiditätspräferenz und das fundamentale psychologische Gesetz der Konsumption, lassen sich empirisch nicht überzeugend nachweisen. Außerdem ist die Theorie sehr unvollständig (unterkomplex). Das Einkommens-Ausgaben-Modell erfasst nur die Rezession, im besten Fall auch den Abschwung, und das ist zweifellos wenig. Von hier bis zu einem geschlossenen Gedankengang, der auch die restlichen zwei Phasen des ökonomischen Zyklus logisch schlüssig erfassen würde, und dazu auch noch die Übergänge zwischen ihnen, liegt jedoch ein langer Weg. Verglichen mit der neoliberalen Theorie, die nur diese restlichen Phasen, also den Aufschwung und Boom erfassen kann, steht die Theorie von Keynes aber nicht schlecht da. Im sportlichen Jargon würde man dies als 2:2 bezeichnen. Der Vergleich hinkt aber. Die neoliberale Theorie besitzt eine mikroökonomische Fundierung ihrer makroökonomischen Wachstums- und Konjunkturmodelle, das partikel-mechanische Gleichgewichtsmodell von Walras und Pareto, Keynes und seine Nachfolger haben jedoch nichts Vergleichbares angeboten. Aus Verzweiflung hat man dann die keynesianischen Makromodelle auf das neoliberale Gleichgewichtsmodell draufgesattelt, mit dem Ergebnis, dass man ihren Ruf endgültig ruiniert hat. Aus der General Theory ist nur ein Sonderfall der neoliberalen Theorie geworden. Keynes müsste sich im Grabe umdrehen.
Das wäre in Kürze alles, was die Wirtschaftswissenschaft heute zu bieten hat. Viel ist es wirklich nicht. Damit hat sich auch unsere ursprüngliche Frage, ob wir ein neues Paradigma überhaupt brauchen, eigentlich beantwortet. Ja, unbedingt! Die bisherigen Theorien zeigen uns keinen Weg, wie wir den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts überwinden könnten. Sie haben ihre endgültige analytische Form oder „normalwissenschaftliche“ Reife, um mit Kuhn zu sprechen, schon längst erreicht und sind nicht mehr ausbaufähig. Wir müssen also Mut fassen und ein neues Paradigma wagen. Ich traue mir diese Herausforderung zu. Das Ergebnis stelle ich nun in den folgenden Beiträgen öffentlich zur Diskussion.
|
|
|