| |
 |
zurück zur Website |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
Das Geheimnis der Veränderung ist,
dass man sich mit all seiner Energie
nicht darauf konzentriert,
das Alte zu bekämpfen,
sondern darauf,
das Neue zu erbauen. |
|
| Sokrates ( *469 - †399 v. Chr. ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Paul Simek |
Marktwirtschaft
neu
denken |
|
|
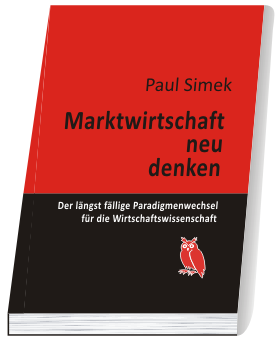 |
|
und |
 |
|
| |
Verlag: |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vorwort |
 |
|
Teil I |
|
| EIN NEUES PARADIGMA FÜR DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT |
|
| Aufbau und Inhalt von Teil I |
 |
|
1: |
Wie die Theorie der liberalen Ordnung
entwickelt, verraten und verfälscht wurde |
 |
|
2: |
Die Keynessche Nachfragetheorie:
ein überforderter Paradigmenwechsel |
 |
|
3: |
Eine neue analytische Grundlage für
das nachfragetheoretische Paradigma |
 |
|
4: |
Die Eignung der (realen) Nachfragetheorie
zur Erklärung marktwirtschaftlicher Tatsachen |
 |
|
Teil II |
|
| REGELUNGEN FÜR EINE FUNKTIONIERENDE MARKTORDNUNG |
|
| Aufbau und Inhalt von Teil II |
 |
|
5: |
Die neue Auffassung über die Affekte
als Geburtsort der geregelten Ordnung |
 |
|
6: |
Wie der Mensch nach Smith wirklich ist
und seine Regeln für die Marktwirtschaft |
 |
|
7: |
Die makroökonomischen Regelungen
für eine funktionierende Marktordnung |
 |
|
8: |
Schuldenfreie Nachfrageschaffung
durch demokratische Geldmarktpolitik |
 |
| Mathematischer Anhang (auf der Website) |
|
 |
 |
|
 |
 |
| Literatur |
 |
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
| |
Inhaltsverzeichnis Teil I |
|
| |
Vorwort
EIN NEUES PARADIGMA FÜR DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
Aufbau und Inhalt von Teil I
1 Wie die Theorie der liberalen Ordnung entwickelt, verraten und verfälscht wurde 8
1.1 Der ursprüngliche Liberalismus von Adam Smith - eine wissenschaftlich konzipierte geregelte Ordnung 9
1.1a Zwei Rationalismen, die moderne Wissenschaft und die Werte 12
1.1b Die Ordnung durch Regeln im Dienste der Werte kurz gefasst 23
1.2 Der Vulgärliberalismus des Sayschen Gesetzes - eine Flucht in die falsche pars-pro-toto Denkweise 26
1.2a Der Sieg des freien Marktes und die „säkulare Stagnation“ 26
1.2b Die Saysche Gesetz als Ergebnis einer problematischen Methode 29
1.3 Der Neoliberalismus nach dem Weltbild der klassischen Mechanik - eine Ideologie für neue Herrschaftsklasse 33
1.3a Der Verrat an den Prinzipien der modernen Wissenschaft 33
1.3b Der Verrat an den Werten des ursprünglichen Liberalismus 42
1.3c Die „postmoderne“ Landung des Liberalismus in der Vormoderne 52
2 Die Keynessche Nachfragetheorie: ein überforderter Paradigmenwechsel 62
2.1 Die empirischen Wurzeln der Auffassung von der fehlenden Nachfrage 63
2.1a Absatzprobleme als offensichtliche Erscheinung der Krisen 64
2.1b Die Innovationen als versuchte Erklärung der Absatzprobleme 66
2.2 Die Geldhortung als Ausgangspunkt der monetären Nachfragetheorie 71
2.2a Die Vollendung der monetären Nachfragetheorie von Keynes 72
2.2b Der Beginn einer monetären Theorie über Zins und Konjunktur 78
2.3 Die Irrtümer und ungelösten Probleme der monetären Nachfragetheorie 79
2.3a Die erfolglose Suche nach dem sozusagen „vergrabenen Geld“ 80
2.3b Die „Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals“ - eine Sackgasse 83
2.3c Die misslungenen Versuche die „General Theory“ nachzubessern 85
3 Eine neue analytische Grundlage für das nachfragetheoretische Paradigma 87
3.1 Kreislauftheoretisches versus partikel-mechanisches Modell 94
3.1a Kumulation als ein wirtschaftliches Phänomen 95
3.1b Gerichtetheit als ein wirtschaftliches Phänomen 98
3.1c Struktur als ein produktionstechnisches Phänomen 99
3.2 Die Erklärung des ,realen‘ Nachfragemangels und des Ungleichgewichts 101
3.2a Einfache Beispiele zur Veranschaulichung des Nachfrageproblems 101
3.2b Der Nachfragemangel und ein Nachruf auf das Saysche Gesetz 109
3.2c Die allgemeine Gleichung des Sparens 110
3.2d Das Problem des allgemeinen Gleichgewichts bzw. der Stabilität 112
3.3 Anhang: Eine kurze Geschichte der kreislauftheoretischen Analyse 114
4 Die Eignung der (realen) Nachfragetheorie zur Erklärung marktwirtschaftlicher Tatsachen 117
4.1 Die Nachfrage als Voraussetzung und Ursprung der Marktwirtschaft 121
4.1a Der historisch einmalige Nachfrageschub durch Edelmetalle 122
4.1b Die endogene Nachfrage durch geldverursachte Preissteigerung 123
4.2 Wie hohe Löhne zur steigenden Produktivität und mehr Nachfrage beitragen 125
4.2a Die Auswanderung als Ursache für steigende Löhne 125
4.2b Die rein theoretische - „mathematisch strenge“ - Lohnanalyse 130
4.2c Zusammenfassung: Der Kapitalismus als Kind der Nachfrage 134
4.3 Die kreislauftheoretische Erklärung der marktwirtschaftlichen Dynamik 135
4.3a Die Dynamik des Wachstums und des ökonomischen Zyklus 137
4.3b Krieg als altbewährter Weg aus der ökonomischen Krise 140
4.3c Der Irrtum der Kapitalakkumulation und der Kapitalknappheit 142
4.4 Weitere nachfragetheoretisch erklärbare „Paradoxe“ der Marktwirtschaft 146
4.4a Das „Paradox“ des Protektionismus und der Monopolduldung 146
4.4b Das „Paradox“ der Preissteigerung von Produktionsgütern 150
4.4c Das „Paradox“ des starrsinnigen Verhaltens des Zinses 151
|
|
| |
|
|
| |
Inhaltsverzeichnis Teil II |
|
| |
REGELUNGEN FÜR EINE FUNKTIONIERENDE MARKTORDNUNG
Aufbau und Inhalt von Teil II:
5 Die neue Auffassung über die Affekte als Geburtsort der geregelten Ordnung 4
5.1 Als das vormoderne Paradigma der Ethik starb und ein neues geboren wurde 6
5.1a Ein weiteres Scheitern der alten Idee der Menschenverbesserung 7
5.1b Die neue Philosophie (Ontologie) und ihre Ethik der Affekte 13
5.1c Spinoza als Vordenker des neuen Ethik- und Ordnungsparadigmas 15
5.1d Das gelöste Geheimnis der Affekte: ihre relative Beständigkeit 18
5.1e Der Konsequentialismus als Ausgangspunkt der Regelungstheorie 22
5.2 Steuerung und Regelung: zwei Möglichkeiten zur Schaffung von Ordnung 27
5.2a Steuerung und Regelung als zwei unterschiedliche Lenkungsarten 28
5.2b Die Idee der Neutralisierung der Affekte und die Rückkoppelung 30
5.2c Regelung als Wissenschaft von nichtdeterministischen Prozessen 35
5.2d Die Regelung als das universale Prinzip der lebenden Welt 40
5.2e Fehlender Sollwert („unsichtbare Hand“) und Stabilitätsproblem 43
5.2f Die Freiheit als „Ordnung des Fortschritts“. Ein Nachruf 45
6 Wie der Mensch nach Smith wirklich ist und seine Regeln für die Marktwirtschaft 49
6.1 Die Erklärung des Menschen durch das Verhalten bzw. die „Sympathie“ 50
6.1a Zwei Bedeutungen von „Sympathie“: emotionale und methodische 51
6.1b Der Mensch als sozial und historisch bestimmtes Wesen 54
6.1c Der Mensch als moralisch und rational beschränktes Wesen 57
6.2 Die (Verhaltens-)Regel für eine gerechte und effiziente Wirtschaftsordnung 59
6.2a Das Problem des Gütertausches unter unvollkommenen Menschen 60
6.2b Der Profit als „Abgeltung“ für die menschliche Unvollkommenheit 62
6.2c Das überflüssige Experiment mit dem „kollektiven“ Kapital 64
6.3 Konkurrenz bzw. Nachfragepreis als die Ursache des Produktivitätswachstums 68
6.3a Die Erste Industrielle Revolution und das technische Wissen 68
6.3b Die Zweite Industrielle Revolution und das technische Wissen 70
6.3c Die Technostruktur und ihre angebliche Innovationsfähigkeit 72
6.3d Das unnötige Experiment mit der Herrschaft der „Intellektuellen“ 77
6.3e Die Ordnungsvision von Adam Smith: Eine kritische Würdigung 79
7 Die makroökonomischen Regelungen für eine funktionierende Marktordnung 87
7.1 Präventive endogene Förderung der Nachfrage statt Kostensenkungen 88
7.1a Steuern als Maßnahme zur Stabilisierung der Nachfrage 89
7.1b Volkswirtschaftliche Regelung der Arbeitszeit und der Lohnquote 95
7.1c Warum eine liberal globalisierte Weltordnung scheitern muss 109
7.2 Exogene Schaffung der neuen Nachfrage durch Staatsausgaben 113
7.2a Staatsausgaben für Güter der finalen Produktionsstufen 113
7.2b Staatsausgaben für Güter der höheren Produktionsstufen 114
8 Schuldenfreie Nachfrageschaffung durch demokratische Geldmarktpolitik 120
8.1 Die ökonomischen Funktionen und der Missbrauch von Geld und Zins 121
8.1a Das Zinsproblem als ein Problem der menschlichen Natur 122
8.1b Die legale Praxis des Finanzsystems zur Ausbeutung der Bürger 125
8.2 Eine Krisenerklärung in der Manier der „klassischen“ neoliberalen Theorie 131
8.2a Die Spitzfindigkeiten zur Erklärung der Wirtschaftskrise 2008 131
8.2b Die Schulden und das angebliche „Leben über die Verhältnisse“ 135
8.3 Das Versagen der monetaristisch komplettierten neoliberalen Theorie 138
8.3a Es hätte sehr lustig sein können, wenn es nicht so traurig wäre 139
8.3b Die „Quantitätsformel“ und das tatsächliche Niveau der Preise 141
8.3c Die „Neutralität“ des Geldes und die empirischen Tatsachen 145
8.4 Kreislauftheoretisch argumentierte Wirkungsweisen und Folgen des Geldes 152
8.4a Zyklustypische Preisbewegungen kreislauftheoretisch erklärt 153
8.4b Die sog. „zurückgestaute“ Inflation aus Buchgeld und QE 154
8.5 Das private Geld als Problem und das demokratische als die Lösung 159
8.5a Das Geld „aus dem Nichts“ im Dienste der ganzen Gesellschaft 163
8.5b Geldschöpfung und Geldmengenregelungen vom und für das Volk 170
Verzeichnis der zitierten Literatur 173
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Bemerkungen und Kommentare zum Buch |
 |
| |
|
|
|
|
| |
 |
Links im Buch zu weiterführenden Beiträgen auf der Website |
|
 |
|
|
|
| |
|
|
|
|